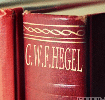|
α. Natürliche Qualitäten
§ 392
Der Geist lebt 1. in seiner Substanz, der natürlichen Seele, das allgemeine planetarische Leben mit, den Unterschied der Klimate, den Wechsel der Jahreszeiten, der Tageszeiten u. dgl.
- ein Naturleben, das in ihm zum Teil nur zu trüben Stimmungen kommt.
Es ist in neueren Zeiten viel vom kosmischen, siderischen, tellurischen Leben des Menschen die Rede geworden. Das Tier lebt wesentlich in dieser Sympathie; dessen spezifischer Charakter sowie seine besonderen Entwicklungen hängen bei vielen ganz, immer mehr oder weniger damit zusammen. Beim Menschen verlieren dergleichen Zusammenhänge um so mehr an Bedeutung, je gebildeter er und je mehr damit sein ganzer Zustand auf freie geistige Grundlage gestellt ist. Die Weltgeschichte hängt nicht mit Revolutionen im Sonnensysteme zusammen, sowenig wie die Schicksale der Einzelnen mit den Stellungen von Planeten.
- Der Unterschied der Klimate enthält eine festere und gewaltigere Bestimmtheit.
Aber den Jahreszeiten, Tageszeiten entsprechen nur schwächere Stimmungen, die in Krankheitszuständen, wozu auch Verrücktheit gehört, in der Depression des selbstbewußten Lebens sich vornehmlich nur hervortun können.
- Unter dem Aberglauben der Völker und den Verirrungen des schwachen Verstandes finden sich bei Völkern, die weniger in der geistigen Freiheit fortgeschritten und darum noch mehr in der Einigkeit mit der Natur leben, auch einige wirkliche Zusammenhänge und darauf sich gründende wunderbar scheinende Voraussehungen von Zuständen und den daran sich knüpfenden Ereignissen. Aber mit der tiefer sich erfassenden Freiheit des Geistes verschwinden auch diese wenigen und geringen Dispositionen, die sich auf das Mitleben mit der Natur gründen. Das Tier wie die Pflanze bleibt dagegen darunter gebunden.
Zusatz.
Aus dem vorhergehenden Paragraphen und aus dem Zusatze zu demselben erhellt, daß das allgemeine Naturleben auch das Leben der Seele ist, daß diese sympathetisch jenes allgemeine Leben mitlebt.
Wenn man nun aber dies Mitleben der Seele mit dem ganzen Universum zum höchsten Gegenstande der Wissenschaft vom Geiste machen will, so ist dies ein vollkommener Irrtum. Denn die Tätigkeit des Geistes besteht gerade wesentlich darin, sich über das Befangensein in dem bloßen Naturleben zu erheben, sich in seiner Selbständigkeit zu erfassen, die Welt seinem Denken zu unterwerfen, dieselbe aus dem Begriffe zu erschaffen. Im Geiste ist daher das allgemeine Naturleben nur ein ganz untergeordnetes Moment; die kosmischen und tellurischen Mächte werden von ihm beherrscht, sie können in ihm nur eine unbedeutende Stimmung hervorbringen.
Das allgemeine Naturleben ist nun erstens das Leben des Sonnensystems überhaupt und zweitens das Leben der Erde, in welchem jenes Leben eine individuellere Form erhält.
Was die Beziehung der Seele zum Sonnensystem betrifft, so kann bemerkt werden, daß die Astrologie die Schicksale des Menschengeschlechts und der Einzelnen mit den Figurationen und Stellungen der Planeten in Verbindung setzt (wie man denn in neuerer Zeit die Welt überhaupt als einen Spiegel des Geistes in dem Sinne betrachtet hat, daß man aus der Welt den Geist erklären könne). Der Inhalt der Astrologie ist als Aberglaube zu verwerfen; es liegt jedoch der Wissenschaft ob, den bestimmten Grund dieser Verwerfung anzugeben. Dieser Grund muß nicht bloß darein gesetzt werden, daß die Planeten von uns fern und Körper seien, sondern bestimmter darein, daß das planetarische Leben des Sonnensystems nur ein Leben der Bewegung, mit anderen Worten ein Leben ist, in welchem Raum und Zeit das Bestimmende ausmachen, denn Raum und Zeit sind die Momente der Bewegung. Die Gesetze der Bewegung der Planeten sind allein durch den Begriff des Raumes und der Zeit bestimmt, in den Planeten hat daher die absolut freie Bewegung ihre Wirklichkeit. Aber schon in dem physikalisch Individuellen ist jene abstrakte Bewegung etwas durchaus Untergeordnetes; das Individuelle überhaupt macht sich selber seinen Raum und seine Zeit; seine Veränderung ist durch seine konkrete Natur bestimmt. Der animalische Körper gelangt zu noch größerer Selbständigkeit als das bloß physikalisch Individuelle: er hat einen von der Bewegung der Planeten ganz unabhängigen Verlauf seiner Entwicklung, ein nicht von ihnen bestimmtes Maß der Lebensdauer; seine Gesundheit, wie der Gang seiner Krankheit, hängt nicht von den Planeten ab, die periodischen Fieber z. B. haben ihr eigenes bestimmtes Maß; bei denselben ist nicht die Zeit als Zeit, sondern der animalische Organismus das Bestimmende. Vollends für den Geist aber haben die abstrakten Bestimmungen von Raum und Zeit, - hat der freie Mechanismus keine Bedeutung und keine Macht; die Bestimmungen des selbstbewußten Geistes sind unendlich gediegener, konkreter als die abstrakten Bestimmungen des Neben- und des Nacheinander. Der Geist, als verkörpert, ist zwar an einem bestimmten Ort und in einer bestimmten Zeit, dennoch aber über Raum und Zeit erhaben. Allerdings ist das Leben des Menschen bedingt durch ein bestimmtes Maß der Entfernung der Erde von der Sonne; in größerer Entfernung von der Sonne könnte er ebensowenig leben wie in geringerer; weiter jedoch reicht der Einfluß der Stellung der Erde auf den Menschen nicht.
Auch die eigentlich terrestrischen Verhältnisse - die in einem Jahre sich vollendende Bewegung der Erde um die Sonne, die tägliche Bewegung der Erde um sich selbst, die Neigung der Erdachse auf die Bahn der Bewegung um die Sonne -, alle diese zur Individualität der Erde gehörenden Bestimmungen sind zwar nicht ohne Einfluß auf den Menschen, für den Geist als solchen aber unbedeutend. Schon die Kirche hat daher den Glauben an eine von jenen terrestrischen und von den kosmischen Verhältnissen über den menschlichen Geist ausgeübte Macht mit Recht als abergläubisch und unsittlich verworfen.
Der Mensch soll sich als frei von den Naturverhältnissen ansehen; in jenem Aberglauben betrachtet er sich aber als Naturwesen.
Man muß demnach auch das Unternehmen derjenigen für nichtig erklären, welche die Epochen in den Evolutionen der Erde mit den Epochen der menschlichen Geschichte in Zusammenhang zu bringen, den Ursprung der Religionen und ihrer Bilder im astronomischen und dann auch im physikalischen Gebiet zu entdecken sich bemüht haben und dabei auf den grund- und bodenlosen Einfall geraten sind, zu meinen:
so wie das Äquinoktium aus dem Stiere in den Widder vorgerückt sei, habe auf den Apisdienst das Christentum, als die Verehrung des Lammes, folgen müssen.
- Was aber den von den terrestrischen Verhältnissen auf den Menschen wirklich ausgeübten Einfluß anbelangt, so kann dieser hier nur nach seinen Hauptmomenten zur Sprache kommen, da das Besondere davon in die Naturgeschichte des Menschen und der Erde gehört. Der Prozeß der Bewegung der Erde erhält in den Jahres- und Tageszeiten eine physikalische Bedeutung.
Diese Wechsel berühren allerdings den Menschen; der bloße Naturgeist, die Seele, durchlebt die Stimmung der Jahres- sowie der Tageszeiten mit. Während aber die Pflanzen ganz an den Wechsel der Jahreszeiten gebunden sind und selbst die Tiere durch denselben bewußtlos beherrscht, durch ihn zur Begattung, einige zur Wanderung instinktmäßig getrieben werden, bringt jener Wechsel in der Seele des Menschen keine Erregungen hervor, denen er willenlos unterworfen wäre.
Die Disposition des Winters ist die Disposition des Insichzurückgehens, des Sichsammelns, des Familienlebens, des Verehrens der Penaten. Im Sommer dagegen ist man zu Reisen besonders aufgelegt, fühlt man sich hinausgerissen ins Freie, drängt sich das gemeine Volk zu Wallfahrten.
Doch weder jenes innigere Familienleben noch diese Wallfahrten und Reisen haben etwas bloß Instinktartiges.
Die christlichen Feste sind mit dem Wechsel der Jahreszeiten in Zusammenhang gebracht;
das Fest der Geburt Christi wird in derjenigen Zeit gefeiert, in welcher die Sonne von neuem hervorzugehen scheint; die Auferstehung Christi ist in den Anfang des Frühlings,
in die Periode des Erwachens der Natur gesetzt.
Aber diese Verbindung des Religiösen mit dem Natürlichen ist gleichfalls keine durch Instinkt,
sondern eine mit Bewußtsein gemachte.
- Was die Mondveränderungen betrifft, so haben diese sogar auf die physische Natur des Menschen nur einen beschränkten Einfluß. Bei Wahnsinnigen hat sich solcher Einfluß gezeigt; aber in diesen herrscht auch die Naturgewalt, nicht der freie Geist.
- Die Tageszeiten ferner führen allerdings eine eigene Disposition der Seele mit sich.
Die Menschen sind des Morgens anders gestimmt als des Abends.
Des Morgens herrscht Ernst, ist der Geist noch mehr in Identität mit sich und mit der Natur.
Der Tag gehört dem Gegensatze, der Arbeit an. Abends ist die Reflexion und Phantasie vorherrschend.
Um Mitternacht geht der Geist aus den Zerstreuungen des Tages in sich, ist mit sich einsam, neigt sich zu Betrachtungen. Nach Mitternacht sterben die meisten Menschen; die menschliche Natur mag da nicht noch einen neuen Tag anfangen.
Die Tageszeiten stehen auch in einer gewissen Beziehung zum öffentlichen Leben der Völker.
Die Volksversammlungen der - mehr als wir - zur Natur hingezogenen Alten wurden des Morgens abgehalten; die englischen Parlamentsverhandlungen werden dagegen, dem in sich gekehrten Charakter der Engländer gemäß, abends begonnen und zuweilen bis in die tiefe Nacht fortgesetzt.
Die angegebenen, durch die Tageszeiten hervorgebrachten Stimmungen werden aber durch das Klima modifiziert; in heißen Ländern zum Beispiel fühlt man sich um Mittag mehr zur Ruhe als zur Tätigkeit aufgelegt. Rücksichtlich des Einflusses der meteorologischen Veränderungen kann folgendes bemerkt werden. Bei Pflanzen und Tieren tritt das Mitempfinden jener Erscheinungen deutlich hervor.
So empfinden die Tiere Gewitter und Erdbeben vorher, d. h. sie fühlen Veränderungen der Atmosphäre,
die noch nicht für uns zur Erscheinung gekommen sind.
So empfinden auch Menschen an Wunden Wetterveränderungen, von welchen das Barometer noch nichts zeigt; die schwache Stelle, welche die Wunde bildet, läßt eine größere Merklichkeit der Naturgewalt zu. Was so für den Organismus bestimmend ist, hat auch für schwache Geister Bedeutung und wird als Wirkung empfunden. Ja, ganze Völker, die Griechen und Römer, machten ihre Entschlüsse von Naturerscheinungen abhängig, die ihnen mit meteorologischen Veränderungen zusammenzuhängen schienen. Sie fragten bekanntlich nicht bloß die Priester, sondern auch die Eingeweide und das Fressen der Tiere um Rat in Staatsangelegenheiten. Am Tage der Schlacht bei Platää z. B., wo es sich um die Freiheit Griechenlands, vielleicht ganz Europas, um Abwehrung des orientalischen Despotismus handelte, quälte sich Pausanias den ganzen Morgen um gute Zeichen der Opfertiere.
Dies scheint in völligem Widerspruch mit der Geistigkeit der Griechen in Kunst, Religion und Wissenschaft zu stehen, kann aber sehr wohl aus dem Standpunkt des griechischen Geistes erklärt werden.
Den Neueren ist eigentümlich, in allem, was die Klugheit unter diesen und diesen Umständen als rätlich erscheinen läßt, sich aus sich selbst zu entschließen; die Privatleute sowohl wie die Fürsten fassen ihre Entschlüsse aus sich selber; der subjektive Wille schneidet bei uns alle Gründe der Überlegung ab und bestimmt sich zur Tat. Die Alten hingegen, welche noch nicht zu dieser Macht der Subjektivität, zu dieser Stärke der Gewißheit ihrer selbst gekommen waren, ließen sich in ihren Angelegenheiten durch Orakel, durch äußere Erscheinungen bestimmen, in denen sie eine Vergewisserung und Bewahrheitung ihrer Vorsätze und Absichten suchten.
Was nun besonders den Fall der Schlacht betrifft, so kommt es dabei nicht bloß auf die sittliche Gesinnung, sondern auch auf die Stimmung der Munterkeit, auf das Gefühl physischer Kraft an. Diese Disposition war aber bei den Alten von noch weit größerer Wichtigkeit als bei den Neueren, bei welchen die Disziplin des Heeres und das Talent des Feldherrn die Hauptsache sind, während umgekehrt bei den mehr noch in der Einheit mit der Natur lebenden Alten die Tapferkeit der Einzelnen, der immer etwas Physisches zu seiner Quelle habende Mut das meiste zur Entscheidung der Schlacht beitrug.
Die Stimmung des Mutes hängt nun mit anderen physischen Dispositionen, zum Beispiel mit der Disposition der Gegend, der Atmosphäre, der Jahreszeit, des Klimas zusammen. Die sympathetischen Stimmungen des beseelten Lebens kommen aber bei den Tieren, da diese noch mehr mit der Natur in Einheit leben, sichtbarer zur Erscheinung als beim Menschen. Aus diesem Grunde ging der Feldherr bei den Griechen nur dann zur Schlacht, wenn er an den Tieren gesunde Dispositionen zu finden glaubte, welche einen Schluß auf gute Dispositionen der Menschen zu erlauben schienen. So opfert der in seinem berühmten Rückzug so klug sich benehmende Xenophon täglich und bestimmt nach dem Ergebnis des Opfers seine militärischen Maßregeln. Das Aufsuchen eines Zusammenhangs zwischen dem Natürlichen und Geistigen wurde aber von den Alten zu weit getrieben. Ihr Aberglaube sah in den Eingeweiden der Tiere mehr, als darin zu sehen ist. Das Ich gab seine Selbständigkeit dabei auf, unterwarf sich den Umständen und Bestimmungen der Äußerlichkeit, machte diese zu Bestimmungen des Geistes.
§ 393
Das allgemeine planetarische Leben des Naturgeistes 2. besondert sich in die konkreten Unterschiede der Erde und zerfällt in die besonderen Naturgeister, die im ganzen die Natur der geographischen Weltteile ausdrücken und die Rassenverschiedenheit ausmachen.
Der Gegensatz der terrestrischen Polarität, durch welchen das Land gegen Norden zusammengedrängter ist und das Übergewicht gegen das Meer hat, gegen die südliche Hemisphäre aber getrennt in Zuspitzungen auseinanderläuft, bringt in den Unterschied der Weltteile zugleich eine Modifikation, die Treviranus (Biologie, Bd. II)7) n Ansehung der Pflanzen und Tiere aufgezeigt hat.
Zusatz.
Rücksichtlich der Rassenverschiedenheit der Menschen muß zuvörderst bemerkt werden, daß die bloß historische Frage, ob alle menschlichen Rassen von einem Paare oder von mehreren ausgegangen seien,
uns in der Philosophie gar nichts angeht. Man hat dieser Frage eine Wichtigkeit beigelegt,
weil man durch die Annahme einer Abstammung von mehreren Paaren die geistige Überlegenheit der einen Menschengattung über die andere erklären zu können glaubte, ja zu beweisen hoffte, die Menschen seien ihren geistigen Fähigkeiten nach von Natur so verschieden, daß einige wie Tiere beherrscht werden dürften. Aus der Abstammung kann aber kein Grund für die Berechtigung oder Nichtberechtigung der Menschen
zur Freiheit und zur Herrschaft geschöpft werden.
Der Mensch ist an sich vernünftig; darin liegt die Möglichkeit der Gleichheit des Rechtes aller Menschen, - die Nichtigkeit einer starren Unterscheidung in berechtigte und rechtlose Menschengattungen.
- Der Unterschied der Menschenrassen ist noch ein natürlicher, d. h. ein zunächst die Naturseele betreffender Unterschied. Als solcher steht derselbe in Zusammenhang mit den geographischen Unterschieden des Bodens, auf welchem sich die Menschen zu großen Massen sammeln.
Diese Unterschiede des Bodens sind dasjenige, was wir die Weltteile nennen. In diesen Gliederungen des Erdindividuums herrscht etwas Notwendiges, dessen nähere Auseinandersetzung in die Geographie gehört. - Die Hauptunterscheidung der Erde ist die in die alte und in die neue Welt. Zunächst bezieht sich dieser Unterschied auf das frühere oder spätere weltgeschichtliche Bekanntwerden der Erdteile.
Diese Bedeutung ist uns hier gleichgültig. Es kommt uns hier auf die den unterscheidenden Charakter der Weltteile ausmachende Bestimmtheit an. In dieser Rücksicht muß gesagt werden, daß Amerika ein jüngeres Ansehen als die alte Welt hat und in seiner historischen Bildung gegen diese zurücksteht. Amerika stellt nur den allgemeinen Unterschied des Norden und des Süden mit einer ganz schmalen Mitte beider Extreme dar.
Die einheimischen Völker dieses Weltteils gehen unter; die alte Welt gestaltet sich in demselben neu.
Diese nun unterscheidet sich von Amerika dadurch, daß sie sich als ein in bestimmte Unterschiede Auseinandergehendes darstellt, in drei Weltteile zerfällt, von welchen der eine, nämlich Afrika, im ganzen genommen als eine der gediegenen Einheit angehörende Masse, als ein gegen die Küste abgeschlossenes Hochgebirge erscheint, der andere, Asien, dem Gegensatze des Hochlandes und großer, von breiten Strömen bewässerter Täler anheimfällt, während der dritte, Europa, da hier Berg und Tal nicht wie in Asien als große Hälften des Weltteils aneinandergefügt sind, sondern sich beständig durchdringen, die Einheit jener unterschiedslosen Einheit Afrikas und des unvermittelten Gegensatzes Asiens offenbart.
Diese drei Weltteile sind durch das Mittelmeer, um welches sie herumliegen, nicht getrennt, sondern verbunden. Nordafrika, bis zum Ende der Sandwüste, gehört seinem Charakter nach schon zu Europa;
die Bewohner dieses Teiles von Afrika sind noch keine eigentlichen Afrikaner, d. h. Neger, sondern mit den Europäern verwandt. So ist auch ganz Vorderasien seinem Charakter nach zu Europa gehörig; die eigentlich asiatische Rasse, die mongolische, wohnt in Hinterasien.
Nachdem wir so die Unterschiede der Weltteile als nicht zufällige, sondern notwendige zu erweisen versucht haben, wollen wir die mit jenen Unterschieden zusammenhängenden Rassenverschiedenheiten des Menschengeschlechts in physischer und geistiger Beziehung bestimmen. Die Physiologie unterscheidet in ersterer Beziehung die kaukasische, die äthiopische und die mongolische Rasse, woran sich noch die malaiische und die amerikanische Rasse reiht, welche aber mehr ein Aggregat unendlich verschiedener Partikularitäten als eine scharf unterschiedene Rasse bilden. Der physische Unterschied aller dieser Rassen zeigt sich nun vorzüglich in der Bildung des Schädels und des Gesichts. Die Bildung des Schädels ist aber durch eine horizontale und eine vertikale Linie zu bestimmen, von welchen die erstere vom äußeren Gehörgange nach der Wurzel der Nase, die letztere vom Stirnbein nach der oberen Kinnlade geht.
Durch den von diesen beiden Linien gebildeten Winkel unterscheidet sich der tierische Kopf vom menschlichen; bei den Tieren ist dieser Winkel äußerst spitz. Eine andere, bei Festsetzung der Rassenverschiedenheiten wichtige, von Blumenbach8) gemachte Bestimmung betrifft das größere oder geringere Hervortreten der Backenknochen. Auch die Wölbung und die Breite der Stirn ist hierbei bestimmend.
Bei der kaukasischen Rasse ist nun jener Winkel fast oder ganz ein rechter. Besonders gilt dies von der italienischen, georgischen und tscherkessischen Physiognomie. Der Schädel ist bei dieser Rasse oben kugelig, die Stirn sanft gewölbt, die Backenknochen sind zurückgedrängt, die Vorderzähne in beiden Kiefern perpendikulär, die Hautfarbe ist weiß, mit roten Wangen, die Haare sind lang und weich.
Das Eigentümliche der mongolischen Rasse zeigt sich in dem Hervorstehen der Backenknochen, in den enggeschlitzten, nicht runden Augen, in der zusammengedrückten Nase, in der gelben Farbe der Haut, in den kurzen, storren, schwarzen Haaren.
Die Neger haben schmälere Schädel als die Mongolen und Kaukasier, ihre Stirnen sind gewölbt, aber bucklig, ihre Kiefer ragen hervor, ihre Zähne stehen schief, ihre untere Kinnlade ist sehr hervortretend, ihre Hautfarbe mehr oder weniger schwarz, ihre Haare sind wollig und schwarz.
Die malaiische und die amerikanische Rasse sind in ihrer physischen Bildung weniger als die eben geschilderten Rassen scharf ausgezeichnet; die Haut der malaiischen ist braun, die der amerikanischen kupferfarbig.
In geistiger Beziehung unterscheiden sich die angegebenen Rassen auf folgende Weise.
Die Neger sind als eine aus ihrer uninteressierten und interesselosen Unbefangenheit nicht heraustretende Kindernation zu fassen. Sie werden verkauft und lassen sich verkaufen, ohne alle Reflexion darüber,
ob dies recht ist oder nicht. Ihre Religion hat etwas Kinderhaftes. Das Höhere, welches sie empfinden, halten sie nicht fest; dasselbe geht ihnen nur flüchtig durch den Kopf. Sie übertragen dies Höhere auf den ersten besten Stein, machen diesen dadurch zu ihrem Fetisch und verwerfen diesen Fetisch, wenn er ihnen nicht geholfen hat. In ruhigem Zustande ganz gutmütig und harmlos, begehen sie in der plötzlich entstehenden Aufregung die fürchterlichsten Grausamkeiten. Die Fähigkeit zur Bildung ist ihnen nicht abzusprechen; sie haben nicht nur hier und da das Christentum mit der größten Dankbarkeit angenommen und mit Rührung von ihrer durch dasselbe nach langer Geistesknechtschaft erlangten Freiheit gesprochen, sondern auch in Haiti einen Staat nach christlichen Prinzipien gebildet. Aber einen inneren Trieb zur Kultur zeigen sie nicht. In ihrer Heimat herrscht der entsetzlichste Despotismus; da kommen sie nicht zum Gefühl der Persönlichkeit des Menschen, - da ist ihr Geist ganz schlummernd, bleibt in sich versunken, macht keinen Fortschritt und entspricht so der kompakten, unterschiedslosen Masse des afrikanischen Landes.
Die Mongolen dagegen erheben sich aus dieser kindischen Unbefangenheit; in ihnen offenbart sich als das Charakteristische eine unruhige, zu keinem festen Resultate kommende Beweglichkeit, welche sie treibt, sich wie ungeheure Heuschreckenschwärme über andere Nationen auszubreiten, und die dann doch wieder der gedankenlosen Gleichgültigkeit und dumpfen Ruhe weicht, welche jenem Hervorbrechen vorangegangen war. Ebenso zeigen die Mongolen an sich den schneidenden Gegensatz des Erhabenen und Ungeheuren einerseits und des kleinlichsten Pedantismus andererseits. Ihre Religion enthält schon die Vorstellung eines Allgemeinen, das von ihnen als Gott verehrt wird. Aber dieser Gott wird noch nicht als ein unsichtbarer ertragen; er ist in menschlicher Gestalt vorhanden oder gibt sich wenigstens durch diesen oder jenen Menschen kund. So bei den Tibetanern, wo oft ein Kind zum gegenwärtigen Gott gewählt und, wenn solcher Gott stirbt, von den Mönchen ein anderer Gott unter den Menschen gesucht wird, alle diese Götter aber nacheinander die tiefste Verehrung genießen. Das Wesentliche dieser Religion erstreckt sich bis zu den Indern, bei denen gleichfalls ein Mensch, der Brahmane, als Gott angesehen und das Sichzurückziehen des menschlichen Geistes in seine unbestimmte Allgemeinheit für das Göttliche, für die unmittelbare Identität mit Gott gehalten wird. In der asiatischen Rasse beginnt also der Geist allerdings schon zu erwachen, sich von der Natürlichkeit zu trennen. Diese Trennung ist aber noch keine scharfe, noch nicht die absolute.
Der Geist erfaßt sich noch nicht in seiner absoluten Freiheit, weiß sich noch nicht als das für sich seiende konkret Allgemeine, hat sich seinen Begriff noch nicht in der Form des Gedankens zum Gegenstande gemacht. Deshalb existiert er noch in der ihm widersprechenden Form der unmittelbaren Einzelheit.
Gott wird zwar gegenständlich, aber nicht in der Form des absolut freien Gedankens, sondern in der eines unmittelbar existierenden endlichen Geistes. Damit hängt die hier vorkommende Verehrung der Verstorbenen zusammen. In dieser liegt eine Erhebung über die Natürlichkeit, denn in den Verstorbenen ist die Natürlichkeit untergegangen; die Erinnerung an dieselben hält nur das in ihnen erschienene Allgemeine fest und erhebt sich somit über die Einzelheit der Erscheinung.
Das Allgemeine wird aber immer nur einerseits als ein ganz abstrakt Allgemeines festgehalten andererseits in einer durchaus zufälligen unmittelbaren Existenz angeschaut. Bei den Indern zum Beispiel wird der allgemeine Gott als in der ganzen Natur, in den Flüssen, Bergen, sowie in den Menschen gegenwärtig betrachtet. Asien stellt also, wie in physischer so auch in geistiger Beziehung, das Moment des Gegensatzes, den unvermittelten Gegensatz, das vermittlungslose Zusammenfallen der entgegengesetzten Bestimmungen dar. Der Geist trennt sich hier einerseits von der Natur und fällt andererseits doch wieder in die Natürlichkeit zurück, da er noch nicht in sich selber, sondern nur in dem Natürlichen zur Wirklichkeit gelangt. In dieser Identität des Geistes mit der Natur ist die wahre Freiheit nicht möglich. Der Mensch kann hier noch nicht zum Bewußtsein seiner Persönlichkeit kommen, hat in seiner Individualität noch gar keinen Wert und keine Berechtigung, weder bei den Indern noch bei den Chinesen; diese setzen ihre Kinder ohne alles Bedenken aus oder bringen dieselben geradezu um.
Erst in der kaukasischen Rasse kommt der Geist zur absoluten Einheit mit sich selber; erst hier tritt der Geist in vollkommenen Gegensatz gegen die Natürlichkeit, erfaßt er sich in seiner absoluten Selbständigkeit, entreißt er sich dem Herüber- und Hinüberschwanken von einem Extrem zum anderen, gelangt zur Selbstbestimmung, zur Entwicklung seiner selbst und bringt dadurch die Weltgeschichte hervor.
Die Mongolen haben, wie schon erwähnt zu ihrem Charakter nur die nach außen stürmende Tätigkeit einer Überschwemmung, die sich so schnell, wie sie gekommen ist, wieder verläuft, bloß zerstörend wirkt, nichts erbaut, keinen Fortschritt der Weltgeschichte hervorbringt.
Dieser kommt erst durch die kaukasische Rasse zustande.
In derselben haben wir aber zwei Seiten, die Vorderasiaten und die Europäer zu unterscheiden, mit welchem Unterschiede jetzt der Unterschied von Mohammedanern und Christen zusammenfällt.
Im Mohammedanismus ist das bornierte Prinzip der Juden durch Erweiterung zur Allgemeinheit überwunden. Hier wird Gott nicht mehr wie bei den Hinterasiaten als auf unmittelbar sinnliche Weise existierend betrachtet, sondern als die über alle Vielheit der Welt erhabene eine unendliche Macht aufgefaßt. Der Mohammedanismus ist daher im eigentlichsten Sinne des Wortes die Religion der Erhabenheit.
Mit dieser Religion steht der Charakter der Vorderasiaten, besonders der Araber, in völligem Einklang.
Dies Volk ist, in seinem Aufschwunge zu dem einen Gotte, gegen alles Endliche, gegen alles Elend gleichgültig, mit seinem Leben wie mit seinen Glücksgütern freigebig; noch jetzt verdient seine Tapferkeit und seine Mildtätigkeit unsere Anerkennung. Aber der an dem abstrakt Einen festhaltende Geist der Vorderasiaten bringt es nicht zur Bestimmung, zur Besonderung des Allgemeinen, folglich nicht zu konkreter Bildung. Durch diesen Geist ist zwar hier alles in Hinterasien herrschende Kastenwesen vernichtet, jedes Individuum unter den mohammedanischen Vorderasiaten frei; eigentlicher Despotismus findet unter denselben nicht statt. Das politische Leben kommt jedoch hier noch nicht zu einem gegliederten Organismus, zur Unterscheidung in besondere Staatsgewalten. Und was die Individuen betrifft, so halten dieselben sich zwar einerseits in einer großartigen Erhabenheit über subjektive, endliche Zwecke, stürzen sich aber andererseits auch wieder mit ungezügeltem Triebe in die Verfolgung solcher Zwecke, die bei ihnen dann alles Allgemeinen entbehren, weil es hier noch nicht zu einer immanenten Besonderung des Allgemeinen kommt. So entsteht hier, neben den erhabensten Gesinnungen, die größte Rachsucht und Arglist.
Die Europäer dagegen haben zu ihrem Prinzip und Charakter das konkret Allgemeine, den sich selbst bestimmenden Gedanken.
Der christliche Gott ist nicht bloß der unterschiedslose Eine, sondern der Dreieinige, der den Unterschied in sich enthaltende, der Mensch gewordene, der sich selbst offenbarende Gott. In dieser religiösen Vorstellung hat der Gegensatz des Allgemeinen und des Besonderen, des Gedankens und des Daseins, die höchste Schärfe und ist gleichwohl zur Einheit zurückgeführt.
So bleibt das Besondere hier nicht so ruhig in seiner Unmittelbarkeit belassen wie im Mohammedanismus, vielmehr ist dasselbe durch den Gedanken bestimmt, wie umgekehrt das Allgemeine sich hier zur Besonderung entwickelt. Das Prinzip des europäischen Geistes ist daher die selbstbewußte Vernunft, die zu sich das Zutrauen hat, daß nichts gegen sie eine unüberwindliche Schranke sein kann, und die daher alles antastet, um sich selber darin gegenwärtig zu werden. Der europäische Geist setzt die Welt sich gegenüber, macht sich von ihr frei, hebt aber diesen Gegensatz wieder auf, nimmt sein Anderes, das Mannigfaltige, in sich, in seine Einfachheit zurück. Hier herrscht daher dieser unendliche Wissensdrang, der den anderen Rassen fremd ist. Den Europäer interessiert die Welt; er will sie erkennen, sich das ihm gegenüberstehende Andere aneignen, in den Besonderungen der Welt die Gattung, das Gesetz, das Allgemeine den Gedanken, die innere Vernünftigkeit sich zur Anschauung bringen.
- Ebenso wie im Theoretischen strebt der europäische Geist auch im Praktischen nach der zwischen ihm und der Außenwelt hervorzubringenden Einheit.
Er unterwirft die Außenwelt seinen Zwecken mit einer Energie, welche ihm die Herrschaft der Welt gesichert hat.
Das Individuum geht hier in seinen besonderen Handlungen von festen allgemeinen Grundsätzen aus,
und der Staat stellt in Europa mehr oder weniger die der Willkür eines Despoten entnommene Entfaltung und Verwirklichung der Freiheit durch vernünftige Institutionen dar.
In betreff aber endlich der ursprünglichen Amerikaner haben wir zu bemerken, daß dieselben ein verschwindendes schwaches Geschlecht sind. In manchen Teilen Amerikas fand sich zwar zur Zeit der Entdeckung desselben eine ziemliche Bildung; diese war jedoch mit der europäischen Kultur nicht zu vergleichen und ist mit den Ureinwohnern verschwunden. Außerdem gibt es dort die stumpfesten Wilden, z. B. die Pescheräs und die Eskimos. Die ehemaligen Karaiben sind fast ganz ausgestorben.
Mit Branntwein und Gewehr bekannt gemacht, sterben diese Wilden aus. In Südamerika sind es die Kreolen, welche sich von Spanien unabhängig gemacht haben; die eigentlichen Indianer wären dazu unfähig gewesen. In Paraguay waren dieselben wie ganz unmündige Kinder und wurden wie solche auch von den Jesuiten behandelt.
Die Amerikaner sind daher offenbar nicht imstande, sich gegen die Europäer zu behaupten. Diese werden auf dem von ihnen dort eroberten Boden eine neue Kultur beginnen.
§ 394
Dieser Unterschied geht in die Partikularitäten hinaus, die man Lokalgeister nennen kann und die sich in der äußerlichen Lebensart, Beschäftigung, körperlichen Bildung und Disposition, aber noch mehr in innerer Tendenz und Befähigung des intelligenten und sittlichen Charakters der Völker zeigen.
So weit die Geschichte der Völker zurückreicht, zeigt sie das Beharrliche dieses Typus der besonderen Nationen.
Zusatz.
Die im Zusatz zum § 393 geschilderten Rassenverschiedenheiten sind die wesentlichen, die durch den Begriff bestimmten Unterschiede des allgemeinen Naturgeistes. Bei dieser seiner allgemeinen Unterscheidung bleibt aber der Naturgeist nicht stehen; die Natürlichkeit des Geistes hat nicht die Macht, sich als den reinen Abdruck der Bestimmungen des Begriffs zu behaupten; sie geht zu weiterer Besonderung jener allgemeinen Unterschiede fort und verfällt so in die Mannigfaltigkeit der Lokal- oder Nationalgeister. Die ausführliche Charakteristik dieser Geister gehört teils in die Naturgeschichte des Menschen, teils in die Philosophie der Weltgeschichte. Die erstere Wissenschaft schildert die durch die Natur mitbedingte Disposition des Nationalcharakters, die körperliche Bildung, die Lebensart, die Beschäftigung, sowie die besonderen Richtungen der Intelligenz und des Willens der Nationen. Die Philosophie der Geschichte dagegen hat zu ihrem Gegenstande die weltgeschichtliche Bedeutung der Völker, das heißt - wenn wir die Weltgeschichte im umfassendsten Sinne des Wortes nehmen - die höchste Entwicklung, zu welcher die ursprüngliche Disposition des Nationalcharakters gelangt, die geistigste Form, zu welcher der in den Nationen wohnende Naturgeist sich erhebt. Hier in der philosophischen Anthropologie können wir uns auf das Detail nicht einlassen, dessen Betrachtung den ebengenannten beiden Wissenschaften obliegt. Wir haben hier den Nationalcharakter nur insofern zu betrachten, als derselbe den Keim enthält, aus welchem die Geschichte der Nationen sich entwickelt.
Zuvörderst kann bemerkt werden, daß der Nationalunterschied ein ebenso fester Unterschied ist wie die Rassenverschiedenheit der Menschen, - daß zum Beispiel die Araber sich noch jetzt überall ebenso zeigen, wie sie in den ältesten Zeiten geschildert werden. Die Unveränderlichkeit des Klimas, der ganzen Beschaffenheit des Landes, in welchem eine Nation ihren bleibenden Wohnsitz hat, trägt zur Unveränderlichkeit des Charakters derselben bei. Eine Wüste, die Nachbarschaft des Meeres oder das Entferntsein vom Meere, - alle diese Umstände können auf den Nationalcharakter Einfluß haben. Besonders ist hierbei der Zusammenhang mit dem Meere wichtig. In dem von hohen Gebirgen dicht am Gestade umgebenen und auf diese Weise vom Meere, diesem freien Elemente, abgesperrten Inneren des eigentlichen Afrika bleibt der Geist der Eingeborenen unaufgeschlossen, fühlt keinen Freiheitstrieb, erträgt ohne Widerstreben die allgemeine Sklaverei. Die Nähe des Meeres kann jedoch für sich allein den Geist nicht frei machen. Dies beweisen die Inder, die sich dem seit frühester Zeit bei ihnen bestehenden Verbot der Beschiffung des von der Natur für sie geöffneten Meeres sklavisch unterworfen haben und so, durch den Despotismus von diesem weiten freien Element, von diesem natürlichen Dasein der Allgemeinheit geschieden, keine Kraft verraten, sich von der die Freiheit tötenden Verknöcherung der Standesabteilungen zu befreien, welche in dem Kastenverhältnis stattfindet und die einer aus eigenem Antriebe das Meer beschiffenden Nation unerträglich sein würde.
Was nun aber den bestimmten Unterschied der Nationalgeister betrifft, so ist derselbe bei der afrikanischen Menschenrasse im höchsten Grade unbedeutend und tritt selbst bei der eigentlich asiatischen Rasse viel weniger als bei den Europäern hervor, in welchen der Geist erst aus seiner abstrakten Allgemeinheit zur entfalteten Fülle der Besonderung gelangt. Wir wollen deshalb hier nur von dem in sich verschiedenen Charakter der europäischen Nationen sprechen und unter denselben auch diejenigen Völker, welche sich hauptsächlich durch ihre weltgeschichtliche Rolle voneinander unterscheiden - nämlich die Griechen, die Römer und die Germanen -, nicht in ihrer gegenseitigen Beziehung charakterisieren; dies Geschäft haben wir der Philosophie der Geschichte zu überlassen. Dagegen können hier die Unterschiede angegeben werden, welche sich innerhalb der griechischen Nation und unter den mehr oder weniger von germanischen Elementen durchdrungenen christlichen Völkern Europas hervorgetan haben.
Was die Griechen anbelangt, so unterscheiden sich die in der Periode ihrer vollen weltgeschichtlichen Entwicklung unter ihnen besonders hervorragenden Völker - die Lakedämonier, die Thebaner und die Athener - auf folgende Weise voneinander. Bei den Lakedämoniern ist das gediegene, unterschiedslose Leben in der sittlichen Substanz vorherrschend; daher kommen bei ihnen das Eigentum und das Familienverhältnis nicht zu ihrem Rechte. Bei den Thebanern dagegen tritt das entgegengesetzte Prinzip hervor; bei denselben hat das Subjektive, das Gemütliche, soweit dies überhaupt schon den Griechen zugesprochen werden kann, das Übergewicht. Der Hauptlyriker der Griechen, Pindar, gehört den Thebanern an. Auch der unter den Thebanern entstandene Freundschaftsbund von Jünglingen, die auf Leben und Tod miteinander verbunden waren, gibt einen Beweis von dem in diesem Volke vorherrschenden Sichzurückziehen in die Innerlichkeit der Empfindung. Das atheniensische Volk aber stellt die Einheit dieser Gegensätze dar; in ihm ist der Geist aus der thebanischen Subjektivität herausgetreten, ohne sich in die spartanische Objektivität des sittlichen Lebens zu verlieren, die Rechte des Staats und des Individuums haben bei den Athenern eine so vollkommene Vereinigung gefunden, als auf dem griechischen Standpunkt überhaupt möglich war. Wie aber Athen durch diese Vermittlung des spartanischen und des thebanischen Geistes die Einheit des nördlichen und des südlichen Griechenlands bildet, so sehen wir in jenem Staate auch die Vereinigung der östlichen und der westlichen Griechen, insofern Platon in demselben das Absolute als die Idee bestimmt hat, in welcher sowohl das in der ionischen Philosophie zum Absoluten gemachte Natürliche als der das Prinzip der italischen Philosophie bildende ganz abstrakte Gedanke zu Momenten herabgesetzt sind. - Mit diesen Andeutungen in betreff des Charakters der Hauptvölker Griechenlands müssen wir uns hier begnügen, durch eine weitere Entwicklung des Angedeuteten würden wir in das Gebiet der Weltgeschichte und namentlich auch der Geschichte der Philosophie übergreifen.
Eine noch weit größere Mannigfaltigkeit des Nationalcharakters erblicken wir bei den christlichen Völkern Europas. Die Grundbestimmung in der Natur dieser Völker ist die überwiegende Innerlichkeit, die in sich feste Subjektivität. Diese modifiziert sich hauptsächlich nach der südlichen oder nördlichen Lage des von diesen Völkern bewohnten Landes. Im Süden tritt die Individualität unbefangen in ihrer Einzelheit hervor. Dies gilt besonders von den Italienern, da will der individuelle Charakter nicht anders sein, als er eben ist, allgemeine Zwecke stören seine Unbefangenheit nicht. Solcher Charakter ist der weiblichen Natur gemäßer als der männlichen. Die italienische Individualität hat sich daher als weibliche Individualität zu ihrer höchsten Schönheit ausgebildet; nicht selten sind italienische Frauen und Mädchen, die in der Liebe unglücklich waren, in einem Augenblick vor Schmerz gestorben, - so sehr war ihre ganze Natur in das individuelle Verhältnis eingegangen, dessen Bruch sie vernichtete. Mit dieser Unbefangenheit der Individualität hängt auch das starke Gebärdenspiel der Italiener zusammen; ihr Geist ergießt sich ohne Rückhalt in seine Leiblichkeit. Denselben Grund hat die Anmut ihres Benehmens. Auch im politischen Leben der Italiener zeigt sich das nämliche Vorherrschen der Einzelheit, des Individuellen. Wie schon vor der römischen Herrschaft, so auch nach deren Verschwinden stellt sich uns Italien als in eine Menge kleiner Staaten zerfallen dar.
Im Mittelalter sehen wir dort die vielen einzelnen Gemeinwesen überall von Faktionen so zerrissen, daß die Hälfte der Bürger solcher Staaten fast immer in der Verbannung lebte. Das allgemeine Interesse des Staats konnte vor dem überwiegenden Parteigeist nicht aufkommen. Die Individuen, die sich zu alleinigen Vertretern des Gemeinwohls aufwarfen, verfolgten selber vorzugsweise ihr Privatinteresse, und zwar mitunter auf höchst tyrannische, grausame Weise. Weder in diesen Alleinherrschaften noch in jenen vom Parteienkampf zerrissenen Republiken vermochte das politische Recht sich zu fester, vernünftiger Gestaltung auszubilden. Nur das römische Privatrecht wurde studiert und der Tyrannei der Einzelnen wie der Vielen als ein notdürftiger Damm entgegengestellt.
Bei den Spaniern finden wir gleichfalls das Vorherrschen der Individualität; dieselbe hat aber nicht die italienische Unbefangenheit, sondern ist schon mehr mit Reflexion verknüpft. Der individuelle Inhalt, der hier geltend gemacht wird, trägt schon die Form der Allgemeinheit. Deshalb sehen wir bei den Spaniern besonders die Ehre als treibendes Prinzip. Das Individuum verlangt hier Anerkennung, nicht in seiner unmittelbaren Einzelheit, sondern wegen der Übereinstimmung seiner Handlungen und seines Benehmens mit gewissen festen Grundsätzen, die nach der Vorstellung der Nation für jeden Ehrenmann Gesetz sein müssen. Indem aber der Spanier sich in allem seinem Tun nach diesen über die Laune des Individuums erhabenen und von der Sophistik des Verstandes noch nicht erschütterten Grundsätzen richtet, kommt er zu größerer Beharrlichkeit als der Italiener, welcher mehr den Eingebungen des Augenblicks gehorcht und mehr in der Empfindung als in festen Vorstellungen lebt. Dieser Unterschied beider Völker tritt besonders in Beziehung auf die Religion hervor. Der Italiener läßt sich durch religiöse Bedenklichkeiten nicht sonderlich in seinem heiteren Lebensgenuß stören. Der Spanier hingegen hat bisher mit fanatischem Eifer am Buchstaben der Lehren des Katholizismus festgehalten und durch die Inquisition die von diesem Buchstaben abzuweichen Verdächtigen jahrhundertelang mit afrikanischer Unmenschlichkeit verfolgt. Auch in politischer Beziehung unterscheiden sich beide Völker auf eine ihrem angegebenen Charakter gemäße Weise.
Die schon von Petrarca sehnlich gewünschte staatliche Einheit Italiens ist noch jetzt ein Traum; dies Land zerfällt noch immer in eine Menge von Staaten, die sich sehr wenig umeinander bekümmern. In Spanien dagegen, wo, wie gesagt, das Allgemeine zu einiger Herrschaft über das Einzelne kommt, sind die einzelnen Staaten, die früher in diesem Lande bestanden, bereits zu einem Staate zusammengeschmolzen, dessen Provinzen allerdings noch eine zu große Selbständigkeit zu behaupten suchen.
Während nun in den Italienern die Beweglichkeit der Empfindung, in den Spaniern die Festigkeit des vorstellenden Denkens überwiegend ist, zeigen die Franzosen sowohl die Festigkeit des Verstandes als die Beweglichkeit des Witzes. Von jeher hat man den Franzosen Leichtsinn vorgeworfen, ebenso Eitelkeit, Gefallsucht. Durch das Streben zu gefallen haben sie es aber zur höchsten Feinheit der gesellschaftlichen Bildung gebracht und eben dadurch sich auf eine ausgezeichnete Weise über die rohe Selbstsucht des Naturmenschen erhoben; denn jene Bildung besteht gerade darin, daß man über sich selber den anderen, mit welchem man zu tun hat, nicht vergißt, sondern denselben beachtet und sich gegen ihn wohlwollend bezeigt. Wie dem Einzelnen so auch dem Publikum beweisen die Franzosen, seien sie Staatsmänner, Künstler oder Gelehrte, in allen ihren Handlungen und Werken die achtungsvollste Aufmerksamkeit.
Doch ist diese Beachtung der Meinung anderer allerdings mitunter in das Streben ausgeartet, um jeden Preis, selbst auf Kosten der Wahrheit, zu gefallen. Auch Ideale von Schwätzern sind aus diesem Streben entstanden.
Was aber die Franzosen für das sicherste Mittel, allgemein zu gefallen, ansehen, ist dasjenige, was sie esprit nennen. Dieser esprit beschränkt sich in oberflächlichen Naturen auf das Kombinieren einander fernliegender Vorstellungen, wird aber in geistreichen Männern, wie z. B. Montesquieu und Voltaire, durch das Zusammenfassen des vom Verstande Getrennten zu einer genialen Form des Vernünftigen; denn das Vernünftige hat eben dies Zusammenfassen zu seiner wesentlichen Bestimmung. Aber diese Form des Vernünftigen ist noch nicht die des begreifenden Erkennens; die tiefen, geistreichen Gedanken, die sich bei solchen Männern wie den genannten vielfältig finden, werden nicht aus einem allgemeinen Gedanken, aus dem Begriff der Sache entwickelt, sondern nur wie Blitze hingeschleudert. Die Schärfe des Verstandes der Franzosen offenbart sich in der Klarheit und Bestimmtheit ihres mündlichen und schriftlichen Ausdrucks. Ihre den strengsten Regeln unterworfene Sprache entspricht der sicheren Ordnung und Bündigkeit ihrer Gedanken. Dadurch sind die Franzosen zu Mustern der politischen und juristischen Darstellung geworden. Aber auch in ihren politischen Handlungen läßt sich die Schärfe ihres Verstandes nicht verkennen. Mitten im Sturm der revolutionären Leidenschaft hat sich ihr Verstand in der Entschiedenheit gezeigt, mit welcher sie die Hervorbringung der neuen sittlichen Weltordnung gegen den mächtigen Bund der zahlreichen Anhänger des Alten durchgesetzt, alle Momente des zu entwickelnden neuen politischen Lebens nacheinander in deren extremster Bestimmtheit und Entgegengesetztheit verwirklicht haben. Gerade indem sie jene Momente auf die Spitze der Einseitigkeit trieben, jedes einseitige politische Prinzip bis zu seinen letzten Konsequenzen verfolgten, sind sie durch die Dialektik der weltgeschichtlichen Vernunft zu einem politischen Zustande geführt worden, in welchem alle früheren Einseitigkeiten des Staatslebens aufgehoben erscheinen.
Die Engländer könnte man das Volk der intellektuellen Anschauung nennen. Sie erkennen das Vernünftige weniger in der Form der Allgemeinheit als in der der Einzelheit. Daher stehen ihre Dichter weit höher als ihre Philosophen. Bei den Engländern tritt die Originalität der Persönlichkeit stark hervor.
Ihre Originalität ist aber nicht unbefangen und natürlich, sondern entspringt aus dem Gedanken, aus dem Willen. Das Individuum will hierin in jeder Beziehung auf sich beruhen, sich nur durch seine Eigentümlichkeit hindurch auf das Allgemeine beziehen. Aus diesem Grunde hat die politische Freiheit bei den Engländern vornehmlich die Gestalt von Privilegien, von hergebrachten, nicht aus allgemeinen Gedanken abgeleiteten Rechten. Daß die einzelnen englischen Gemeinen und Grafschaften Deputierte ins Parlament schicken, beruht überall auf besonderen Privilegien, nicht auf allgemeinen konsequent durchgeführten Grundsätzen.
Allerdings ist der Engländer auf die Ehre und die Freiheit seiner ganzen Nation stolz; aber sein Nationalstolz hat vornehmlich das Bewußtsein zur Grundlage, daß in England das Individuum seine Besonderheit festhalten und durchführen kann. Mit dieser Zähigkeit der zwar dem Allgemeinen zugetriebenen, aber in ihrer Beziehung auf das Allgemeine an sich selber festhaltenden Individualität hängt die hervorstechende Neigung der Engländer zum Handel zusammen.
Der Deutschen gedenken die Deutschen gewöhnlich zuletzt, entweder aus Bescheidenheit oder weil man das Beste für das Ende aufspart. Wir sind als tiefe, jedoch nicht selten unklare Denker bekannt; wir wollen die innerste Natur der Dinge und ihren notwendigen Zusammenhang begreifen; daher gehen wir in der Wissenschaft äußerst systematisch zu Werke; nur verfallen wir dabei mitunter in den Formalismus eines äußerlichen, willkürlichen Konstruierens. Unser Geist ist überhaupt mehr als der irgendeiner anderen europäischen Nation nach innen gekehrt. Wir leben vorzugsweise in der Innerlichkeit des Gemüts und des Denkens. In diesem Stilleben, in dieser einsiedlerischen Einsamkeit des Geistes beschäftigen wir uns damit, bevor wir handeln, erst die Grundsätze, nach denen wir zu handeln gedenken, sorgfältigst zu bestimmen. Daher kommt es, daß wir etwas langsam zur Tat schreiten, mitunter in Fällen, wo schneller Entschluß notwendig ist, unentschlossen bleiben und, bei dem aufrichtigen Wunsche, die Sache recht gut zu machen, häufig gar nichts zustande bringen. Man kann daher mit Recht das französische Sprichwort: le meilleur tue le bien, auf die Deutschen anwenden. Alles, was getan werden soll, muß bei denselben durch Gründe legitimiert sein. Da sich aber für alles Gründe auffinden lassen, wird dies Legitimieren oft zum bloßen Formalismus, bei welchem der allgemeine Gedanke des Rechts nicht zu seiner immanenten Entwicklung kommt, sondern eine Abstraktion bleibt, in die das Besondere von außen sich willkürlich eindrängt.
Dieser Formalismus hat sich bei den Deutschen auch darin gezeigt, daß sie zuweilen Jahrhunderte hindurch damit zufrieden gewesen sind, gewisse politische Rechte bloß durch Protestationen sich zu bewahren. Während aber auf diese Weise die Untertanen sehr wenig für sich selbst taten, haben sie andererseits oft auch äußerst wenig für die Regierung getan. In der Innerlichkeit des Gemütes lebend, haben die Deutschen zwar immer sehr gern von ihrer Treue und Redlichkeit gesprochen, sind aber oft nicht zur Bewährung dieser ihrer substantiellen Gesinnung zu bringen gewesen, sondern haben gegen Fürsten und Kaiser die allgemeinen staatsrechtlichen Normen nur zur Verhüllung ihrer Ungeneigtheit, etwas für den Staat zu tun, unbedenklich und unbeschadet ihrer vortrefflichen Meinung von ihrer Treue und Redlichkeit, gebraucht.
Obgleich aber ihr politischer Geist, ihre Vaterlandsliebe meistenteils nicht sehr lebendig war,
so sind sie doch seit früher Zeit von einem außerordentlichen Verlangen nach der Ehre einer amtlichen Stellung beseelt und der Meinung gewesen, das Amt und der Titel mache den Mann, nach dem Unterschied des Titels könne die Bedeutsamkeit der Personen und die denselben schuldige Achtung fast in jedem Fall mit vollkommener Sicherheit abgemessen werden; wodurch die Deutschen in eine Lächerlichkeit verfallen sind, die in Europa nur an der Sucht der Spanier nach einer langen Liste von Namen eine Parallele findet.
§ 395
Die Seele ist 3. zum individuellen Subjekte vereinzelt. Diese Subjektivität kommt aber hier nur als Vereinzelung der Naturbestimmtheit in Betracht. Sie ist als der Modus des verschiedenen Temperaments, Talents, Charakters, der Physiognomie und anderer Dispositionen und Idiosynkrasien von Familien oder den singulären Individuen.
Zusatz.
Wie wir gesehen haben, geht der Naturgeist zuerst in die allgemeinen Unterschiede der Menschengattungen auseinander und kommt in den Volksgeistern zu einem Unterschiede, welcher die Form der Besonderung hat. Das dritte ist, daß der Naturgeist zu seiner Vereinzelung fortschreitet und als individuelle Seele sich selber sich entgegensetzt. Der hier entstehende Gegensatz ist aber noch nicht derjenige Gegensatz, welcher zum Wesen des Bewußtseins gehört. Die Einzelheit oder Individualität der Seele kommt hier in der Anthropologie nur als Naturbestimmtheit in Betracht.
Zunächst muß nun über die individuelle Seele bemerkt werden, daß in derselben die Sphäre des Zufälligen beginnt, da nur das Allgemeine das Notwendige ist. Die einzelnen Seelen unterscheiden sich voneinander durch eine unendliche Menge von zufälligen Modifikationen. Diese Unendlichkeit gehört aber zur schlechten Art des Unendlichen. Man darf daher die Eigentümlichkeit der Menschen nicht zu hoch anschlagen. Vielmehr muß man für ein leeres, ins Blaue gehendes Gerede die Behauptung erklären, daß der Lehrer sich sorgfältig nach der Individualität jedes seiner Schüler zu richten, dieselbe zu studieren und auszubilden habe Dazu hat er gar keine Zeit. Die Eigentümlichkeit der Kinder wird im Kreise der Familie geduldet, aber mit der Schule beginnt ein Leben nach allgemeiner Ordnung, nach einer allen gemeinsamen Regel; da muß der Geist zum Ablegen seiner Absonderlichkeiten, zum Wissen und Wollen des Allgemeinen, zur Aufnahme der vorhandenen allgemeinen Bildung gebracht werden. Dies Umgestalten der Seele - nur dies heißt Erziehung. Je gebildeter ein Mensch ist, desto weniger tritt in seinem Betragen etwas nur ihm Eigentümliches, daher Zufälliges hervor.
Die Eigentümlichkeit des Individuums hat nun aber verschiedene Seiten. Man unterscheidet dieselbe nach den Bestimmungen des Naturells, des Temperaments und des Charakters.
Unter dem Naturell versteht man die natürlichen Anlagen im Gegensatze gegen dasjenige, was der Mensch durch seine eigene Tätigkeit geworden ist. Zu diesen Anlagen gehört das Talent und das Genie. Beide Worte drücken eine bestimmte Richtung aus, welche der individuelle Geist von Natur erhalten hat. Das Genie ist jedoch umfassender als das Talent, das letztere bringt nur im Besonderen Neues hervor, wogegen das Genie eine neue Gattung erschafft. Talent und Genie müssen aber, da sie zunächst bloße Anlagen sind - wenn sie nicht verkommen, sich verliederlichen oder in schlechte Originalität ausarten sollen -, nach allgemeingültigen Weisen ausgebildet werden. Nur durch diese Ausbildung bewähren jene Anlagen ihr Vorhandensein, ihre Macht und ihren Umfang. Vor dieser Ausbildung kann man sich über das Dasein eines Talentes täuschen; frühe Beschäftigung mit Malen zum Beispiel kann Talent zu dieser Kunst zu verraten scheinen und dennoch diese Liebhaberei nichts zuwege bringen. Das bloße Talent ist daher auch nicht höher zu schätzen als die durch ihre eigene Tätigkeit zur Erkenntnis ihres Begriffs gekommene Vernunft, - als das absolut freie Denken und Wollen. In der Philosophie führt das bloße Genie nicht weit; da muß sich dasselbe der strengen Zucht des logischen Denkens unterwerfen, nur durch diese Unterwerfung gelangt dort das Genie zu seiner vollkommenen Freiheit.
Was aber den Willen betrifft, so kann man nicht sagen, daß es ein Genie zur Tugend gebe; denn die Tugend ist etwas Allgemeines, von allen Menschen zu Forderndes und nichts Angeborenes, sondern etwas in dem Individuum durch dessen eigene Tätigkeit Hervorzubringendes. Die Unterschiede des Naturells haben daher für die Tugendlehre gar keine Wichtigkeit; dieselben würden nur - wenn wir uns so ausdrücken dürfen - in einer Naturgeschichte des Geistes zu betrachten sein.
Die mannigfaltigen Arten des Talents und des Genies unterscheiden sich voneinander durch die verschiedenen geistigen Sphären, in welchen sie sich betätigen. Der Unterschied der Temperamente dagegen hat keine solche Beziehung nach außen. Es ist schwer zu sagen, was man unter Temperament verstehe. Dasselbe bezieht sich nicht auf die sittliche Natur der Handlung, noch auf das in der Handlung sichtbar werdende Talent, noch endlich auf die immer einen bestimmten Inhalt habende Leidenschaft. Am besten wird man daher das Temperament als die ganz allgemeine Art und Weise bestimmen, wie das Individuum tätig ist, sich objektiviert, sich in der Wirklichkeit erhält. Aus dieser Bestimmung geht hervor, daß für den freien Geist das Temperament nicht so wichtig ist, wie man früherhin gemeint hat. In der Zeit größerer Bildung verlieren sich die mannigfaltigen, zufälligen Manieren des Benehmens und Handelns und damit die Temperamentsverschiedenheiten, geradeso wie in solcher Zeit die bornierten Charaktere der in einer ungebildeteren Epoche entstandenen Lustspiele - die vollkommen Leichtsinnigen, die lächerlich Zerstreuten, die filzig Geizigen - viel seltener werden. Die versuchten Unterscheidungen des Temperaments haben etwas so Unbestimmtes, daß man von denselben wenig Anwendung auf die Individuen zu machen weiß, da in diesen die einzeln dargestellten Temperamente sich mehr oder weniger vereinigt finden. Bekanntlich hat man, ebenso wie man die Tugend in vier Haupttugenden unterschied, vier Temperamente das cholerische, das sanguinische, das phlegmatische und das melancholische - angenommen. Kant spricht über dieselben weitläufig.9) Der Hauptunterschied dieser Temperamente beruht darauf, daß entweder der Mensch sich in die Sache hineinbegibt oder es ihm mehr um seine Einzelheit zu tun ist.
Der erstere Fall findet bei den Sanguinischen und Phlegmatischen, der letztere bei den Cholerischen und Melancholischen statt. Der Sanguinische vergißt sich über der Sache, und zwar bestimmter so, daß er vermöge seiner oberflächlichen Beweglichkeit sich in einer Mannigfaltigkeit von Sachen herumwälzt; wogegen der Phlegmatische sich beharrlich auf eine Sache richtet. Bei den Cholerischen und Melancholischen aber ist, wie schon angedeutet, das Festhalten an der Subjektivität überwiegend; diese beiden Temperamente unterscheiden sich jedoch voneinander wieder dadurch, daß in dem Cholerischen die Beweglichkeit, in dem Melancholischen die Unbeweglichkeit das Übergewicht hat, so daß in dieser Beziehung das Cholerische dem Sanguinischen, das Melancholische dem Phlegmatischen entspricht.
Wir haben bereits bemerkt, daß der Unterschied des Temperaments seine Wichtigkeit in einer Zeit verliert, wo die Art und Weise des Benehmens und der Tätigkeit der Individuen durch die allgemeine Bildung festgesetzt ist. Dagegen bleibt der Charakter etwas, das die Menschen immer unterscheidet.
Durch ihn kommt das Individuum erst zu seiner festen Bestimmtheit. Zum Charakter gehört erstlich das Formelle der Energie, mit welcher der Mensch, ohne sich irremachen zu lassen, seine Zwecke und Interessen verfolgt und in allen seinen Handlungen die Übereinstimmung mit sich selber bewahrt.
Ohne Charakter kommt der Mensch nicht aus seiner Unbestimmtheit heraus oder fällt aus einer Richtung in die entgegengesetzte. An jeden Menschen ist daher die Forderung zu machen, daß er Charakter zeige.
Der charaktervolle Mensch imponiert anderen, weil sie wissen, was sie an ihm haben. Zum Charakter gehört aber, außer der formellen Energie, zweitens ein gehaltvoller, allgemeiner Inhalt des Willens.
Nur durch Ausführung großer Zwecke offenbart der Mensch einen großen, ihn zum Leuchtturm für andere machenden Charakter; und seine Zwecke müssen innerlich berechtigte sein, wenn sein Charakter die absolute Einheit des Inhalts und der formellen Tätigkeit des Willens darstellen und somit vollkommene Wahrheit haben soll. Hält dagegen der Wille an lauter Einzelheiten, an Gehaltlosem fest, so wird derselbe zum Eigensinn. Dieser hat vom Charakter nur die Form, nicht den Inhalt. Durch den Eigensinn, diese Parodie des Charakters, erhält die Individualität des Menschen eine die Gemeinschaft mit anderen störende Zuspitzung.
Noch individuellerer Art sind die sogenannten Idiosynkrasien, die sowohl in der physischen wie in der geistigen Natur des Menschen vorkommen. So wittern zum Beispiel manche Menschen in ihrer Nähe befindliche Katzen. Andere werden von gewissen Krankheiten ganz eigen affiziert. Jakob I. von England ward ohnmächtig, wenn er einen Degen sah. Die geistigen Idiosynkrasien zeigen sich besonders in der Jugend, z. B. in der unglaublichen Schnelligkeit des Kopfrechnens einzelner Kinder. Übrigens unterscheiden sich durch die oben besprochenen Formen der Naturbestimmtheit des Geistes nicht bloß die Individuen, sondern mehr oder weniger auch Familien voneinander, besonders da, wo dieselben sich nicht mit Fremden, sondern nur untereinander verbunden haben, wie es z. B. in Bern und in manchen deutschen Reichsstädten der Fall gewesen ist.
Nachdem wir hiermit die drei Formen der qualitativen Naturbestimmtheit der individuellen Seele - das Naturell, das Temperament und den Charakter - geschildert haben, bleibt uns hierbei noch übrig, die vernünftige Notwendigkeit anzudeuten, warum jene Naturbestimmtheit gerade diese drei und keine anderen Formen hat und warum diese Formen in der von uns befolgten Ordnung zu betrachten sind.
Wir haben mit dem Naturell, und zwar bestimmter mit dem Talent und dem Genie angefangen, weil in dem Naturell die qualitative Naturbestimmtheit der individuellen Seele überwiegend die Form eines bloß Seienden, eines unmittelbar Festen und eines solchen hat, dessen Unterscheidung in sich selber sich auf einen außer ihm vorhandenen Unterschied bezieht. Im Temperament dagegen verliert jene Naturbestimmtheit die Gestalt eines so Festen; denn während in dem Individuum entweder ein Talent ausschließlich herrscht oder in ihm mehrere Talente ihr ruhiges, übergangsloses Bestehen nebeneinander haben, kann ein und dasselbe Individuum von jeder Temperamentsstimmung in die andere übergehen, so daß keine in ihm ein festes Sein hat. Zugleich wird in den Temperamenten der Unterschied der fraglichen Naturbestimmtheit aus der Beziehung auf etwas außer der individuellen Seele Vorhandenes in das Innere derselben reflektiert. Im Charakter aber sehen wir die Festigkeit des Naturells mit der Veränderlichkeit der Temperamentsstimmungen, - die in dem ersteren vorwaltende Beziehung nach außen mit dem in den Temperamentsstimmungen herrschenden Insichreflektiertsein der Seele vereinigt.
Die Festigkeit des Charakters ist keine so unmittelbare, so angeborene wie die des Naturells, sondern eine durch den Willen zu entwickelnde.
Der Charakter besteht in etwas mehr als in einem gleichmäßigen Gemischtsein der verschiedenen Temperamente. Gleichwohl kann nicht geleugnet werden, daß derselbe eine natürliche Grundlage hat,
daß einige Menschen zu einem starken Charakter von der Natur mehr disponiert sind als andere.
Aus diesem Grunde haben wir das Recht gehabt, hier in der Anthropologie vom Charakter zu sprechen, obgleich derselbe seine volle Entfaltung erst in der Sphäre des freien Geistes erhält.
7) Gottfried Reinhold Treviranus, Biologie, oder Philosophie der lebenden Natur für Naturforscher und Ärzte, 6 Bde., Göttingen 1802-22
8) Johann Friedrich Blumenbach, 1752-1840, Anatom und Anthropologe (Kraniologie), schuf die Lehre vom "Bildungstrieb".
9) Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Zweiter Teil, B 256-263
>>>
Der subjektive Geist
Anthropologie
natürliche Seele
Veränderungen
Empfindung
fühlende Seele
fühlende Seele 2
Selbstgefühl
Die Gewohnheit
wirkliche Seele
Bewußtsein
|
|