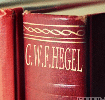|
c. Der Klang
§ 300
Die spezifische Einfachheit der Bestimmtheit, welche der Körper in der Dichtigkeit und dem Prinzip seiner Kohäsion hat, diese zuerst innerliche Form, hindurchgegangen durch ihr Versenktsein in das materielle Außereinander, wird frei in der Negation des für sich Bestehens dieses seines Außereinanderseins. Es ist dies das Übergehen der materiellen Räumlichkeit in materielle Zeitlichkeit. Damit, daß diese Form so im Erzittern, d. i. durch die momentane ebenso Negation der Teile wie Negation dieser ihrer Negation, die aneinander gebunden eine durch die andere erweckt wird, und so, als ein Oszillieren des Bestehens und der Negation der spezifischen Schwere und Kohäsion, am Materiellen als dessen Idealität ist, ist die einfache Form für sich existierend und kommt als diese mechanische Seelenhaftigkeit zur Erscheinung.
Reinheit oder Unreinheit des eigentlichen Klanges, die Unterschiede desselben von bloßem Schall (durch einen Schlag auf einen soliden Körper), Geräusch usf. hängt damit zusammen, ob der durchdringend erzitternde Körper in sich homogen ist, aber dann ferner mit der spezifischen Kohäsion, mit seiner sonst räumlichen Dimensionsbestimmung, ob er eine materielle Linie, materielle Fläche und dabei eine begrenzte Linie und Fläche oder ein solider Körper ist. - Das kohäsionslose Wasser ist ohne Klang, und seine Bewegung, als bloß äußerliche Reibung seiner schlechthin verschiebbaren Teile, gibt nur ein Rauschen. Die bei seiner inneren Sprödigkeit existierende Kontinuität des Glases klingt, noch mehr die unspröde Kontinuität des Metalls klingt durch und durch in sich, usf.
Die Mitteilbarkeit des Klangs, dessen sozusagen klanglose, der Wiederholung und Rückkehr des Zitterns entbehrende Fortpflanzung durch alle in Sprödigkeit usf. noch so verschieden bestimmten Körper (durch feste Körper besser als durch die Luft - durch die Erde auf viele Meilen weit, durch Metalle nach der Berechnung zehnmal schneller als durch Luft) zeigt die durch sie frei hindurchziehende Idealität, welche ganz nur deren abstrakte Materialität ohne die spezifischen Bestimmungen ihrer Dichtigkeit, Kohäsion und weiterer Formierungen in Anspruch nimmt und ihre Teile in die Negation, ins Erzittern bringt; dieses Idealisieren selbst nur ist das Mitteilen.
Das Qualitative des Klanges überhaupt, wie des sich selbst artikulierenden Klanges, des Tones, hängt von der Dichtigkeit, Kohäsion und weiter spezifizierten Kohäsionsweise des klingenden Körpers ab, weil die Idealität oder Subjektivität, welche das Erzittern ist, als Negation jener spezifischen Qualitäten, sie zum Inhalte und zur Bestimmtheit hat; hiermit ist dies Erzittern und der Klang selbst danach spezifiziert und haben die Instrumente ihren eigentümlichen Klang und Timbre.
Zusatz.
Der Klang gehört dem Reiche des Mechanismus an, da er es mit der schweren Materie zu tun hat. Die Form, als sich dem Schweren entreißend, aber ihm noch angehörend, ist somit noch bedingt: die freie physikalische Äußerung des Ideellen, die aber an das Mechanische geknüpft ist, - die Freiheit in der schweren Materie zugleich von dieser Materie. Die Körper klingen noch nicht aus sich selbst, wie das Organische, sondern nur wenn sie angeschlagen werden. Die Bewegung, der äußere Stoß, setzt sich fort, indem die innere Kohäsion gegen ihn als gegen das bloß Massenhafte, nach dem sie behandelt werden soll, ihre Erhaltung beweist. Diese Erscheinungen der Körperlichkeit sind uns sehr geläufig, zugleich sind sie sehr mannigfaltig, und das macht, daß es schwer ist, sie im notwendigen Zusammenhang durch den Begriff darzustellen. Weil sie uns trivial sind, darum achten wir sie nicht; aber auch sie müssen sich als notwendige Momente zeigen, die im Begriffe ihre Stelle haben. Beim Ton der Körper fühlen wir, wir betreten eine höhere Sphäre, der Ton berührt unsere innerste Empfindung. Er spricht die innere Seele an, weil er selbst das Innerliche, Subjektive ist. Der Klang für sich ist das Selbst der Individualität, aber nicht das abstrakt Ideelle wie das Licht, sondern gleichsam das mechanische Licht, nur als Zeit der Bewegung an der Kohärenz hervortretend. Zur Individualität gehört Materie und Form; der Klang ist diese totale Form, die sich in der Zeit kundgibt, - die ganze Individualität, welche weiter nichts ist, als daß diese Seele nun mit dem Materiellen in eins gesetzt ist und es beherrscht als ein ruhiges Bestehen. Was sich hier zeigt, dem liegt nicht Materie zugrunde; denn es hat nicht seine Objektivität in einem Materiellen. Nur der Verstand nimmt zum Behuf der Erklärung ein objektives Sein an, indem er von einer Schallmaterie, wie von Wärmematerie, spricht. Der natürliche Mensch verwundert sich über einen Schall, weil sich darin ein Insichsein offenbart;
er setzt dabei aber nicht ein Materielles, sondern vielmehr ein Seelenhaftes voraus. Es findet hier ein ähnliches Hervortreten statt, als wir bei der Bewegung sahen, wo die bloße Geschwindigkeit oder die Entfernung (beim Hebel) als eine Weise sich zeigt, die statt eines quantitativ Materiellen gesetzt werden kann. Solche Erscheinung, daß ein Insichsein als physikalisch zur Existenz kommt, kann uns nicht in Verwunderung setzen, denn in der Naturphilosophie liegt eben dies zugrunde, daß die Gedankenbestimmungen sich als das Wirkende zeigen.
Das Nähere der Natur des Klanges ist nur kurz anzugeben, indem diese Gedankenbestimmung empirisch durchzugehen ist. Wir haben viele Ausdrücke: Schall, Ton, Geräusch; und ebenso: knarren, zischen, rauschen usw. Das ist ein ganz überflüssiger Reichtum in der Sprache, so das Sinnliche zu bestimmen;
da der Ton gegeben ist, so bedarf es keiner Mühe, ein Zeichen dafür zu machen durch die unmittelbare Übereinstimmung. Das bloß Flüssige ist nicht klingend; der Eindruck teilt sich freilich dem Ganzen mit, aber dieses Mitteilen kommt von der gänzlichen Formlosigkeit, dem gänzlichen Mangel innerer Determination her; der Klang dagegen setzt die Identität der Determination voraus und ist Form in sich selbst.
Da zum reinen Klang gediegene Kontinuität und Gleichheit der Materie in sich gehört, so haben Metalle (besonders edlere) und Glas diesen klaren Klang in sich selbst, was durch Schmelzung hervorgebracht wird. Wenn dagegen eine Glocke z. B. einen Riß bekommen hat, so hören wir nicht nur das Schwingen, sondern auch den sonstigen Widerstand, Sprödes, Ungleichförmiges, und so haben wir einen unreinen Klang, der Geräusch ist. Steinplatten geben auch einen Klang, obgleich sie spröde sind; Luft und Wasser klingen dagegen nicht für sich selbst, wenn sie auch der Mitteilung des Klanges fähig sind.
Die Geburt des Klanges ist schwer zu fassen. Das spezifische Insichsein, von der Schwere geschieden, ist, als hervortretend, der Klang; er ist die Klage des Ideellen in dieser Gewalt des Anderen, ebenso aber auch sein Triumph über dieselbe, indem es sich in ihr erhält. Der Klang hat zweierlei Weisen seiner Hervorbringung: αa) durch Reibung, β) durch eigentliches Schwingen, Elastizität des Insichseins.
Bei der Reibung ist auch dieses vorhanden, daß während ihrer Dauer eine Mannigfaltigkeit in eins gesetzt wird, indem die verschiedenen außereinander seienden Teile momentan in Berührung gebracht werden.
Die Stelle eines jeden, somit seine Materialität, wird aufgehoben; sie stellt sich aber ebenso wieder her. Diese Elastizität ist es eben, die sich durch den Klang kundgibt. Aber wird der Körper gerieben, so wird dieses Schlagen selbst gehört, und diesem Tone entspricht eher das, was wir Schall nennen. Ist das Erzittern des Körpers durch einen äußeren Körper gesetzt, so kommt das Erzittern beider Körper zu uns; beides greift ineinander und läßt keinen Ton rein. Die Bebung ist dann nicht sowohl selbständig, sondern gegenseitig gezwungen; das nennen wir dann Geräusch. Bei schlechten Instrumenten hört man so das Klappern, das mechanische Anschlagen, z. B. das Kratzen des Bogens auf der Violine, ebenso hört man bei einer schlechten Stimme das Erzittern der Muskeln. Das andere, höhere Tönen ist das Erzittern des Körpers in sich selbst, die innerliche Negation und das Sichwiederherstellen. Der eigentliche Klang ist das Nachhallen, dieses ungehinderte innere Schwingen des Körpers, das frei durch die Natur seiner Kohärenz bestimmt ist. Es gibt noch eine dritte Weise, wo die äußere Erregung und das Schallen des Körpers homogen ist; das ist der Gesang des Menschen. In der Stimme ist erst diese Subjektivität oder Selbständigkeit der Form vorhanden; diese bloß erzitternde Bewegung hat so etwas Geistermäßiges.
Die Violine tönt auch nicht nach; sie tönt nur, solange die Saite gerieben wird.
Fragen wir noch in bezug auf den Klang überhaupt, warum er sich aufs Gehör bezieht, so müssen wir antworten: weil dieser Sinn ein Sinn des Mechanismus ist, und zwar eben derjenige, der sich auf das Entfliehen aus der Materialität, auf das Übergehen zum Immateriellen, Seelenhaften, Ideellen bezieht.
Alles dagegen, was spezifische Schwere und Kohäsion ist, bezieht sich auf den Sinn des Gefühls; der Tastsinn ist so der andere Sinn der mechanischen Sphäre, nämlich insofern sie die Bestimmungen der Materialität selbst enthält.
Der besondere Ton, den die Materie hervorbringt, hängt von der Natur ihrer Kohärenz ab: und diese spezifischen Differenzen haben auch einen Zusammenhang mit der Höhe und Tiefe des Tons.
Die eigentliche Bestimmtheit des Tons kann aber eigentlich nur hervortreten durch die Vergleichung des Klingens eines Körpers mit sich selbst. Was den ersten Punkt betrifft, so haben die Metalle z. B. ihren bestimmten spezifischen Klang, wie Silber- und Erzklang. Gleich dicke und gleich lange Stäbe von verschiedenen Stoffen geben verschiedene Töne: Fischbein gibt a an, Zinn h, Silber d in der höheren Oktave, Kölnische Pfeifen e, Kupfer g, Glas c in einer noch höheren Oktave, Tannenholz cis usw., wie Chladni beobachtet hat90) . Ritter91) , erinnere ich mich, hat viel den Klang der verschiedenen Teile des Kopfes, wo er hohler klingt, untersucht und beim Anschlagen der verschiedenen Knochen desselben eine Verschiedenheit der Töne gefunden, die er in eine bestimmte Skala brachte. So gibt es auch ganze Köpfe, die hohl klingen; aber dies Hohlklingen war dabei nicht mitgezählt. Doch wäre es die Frage, ob nicht wirklich die verschiedenen Köpfe derer, die man Hohlköpfe nennt, hohler klingen.
Nach Biots Versuchen tönt nicht allein die Luft, sondern jeder andere Körper teilt den Ton mit; schlägt man z. B. eine irdene oder metallene Röhre bei einer Wasserleitung an, so macht sich einige Meilen davon am anderen Ende des Mundes der Röhre der Ton hörbar, und man unterscheidet dann zwei Töne, wobei der durch das Material der Röhre fortgeleitete Ton weit früher gehört wird als der, welcher durch die Luftsäule fortgeleitet ist. Der Ton wird weder durch Berge noch durch Wasser noch durch Waldungen gehemmt. Merkwürdig ist die Mitteilbarkeit des Klangs durch die Erde, indem man z. B., wenn man das Ohr an die Erde legt, eine Kanonade auf zehn bis zwanzig Meilen weit hören kann; auch verbreitet sich der Ton durch die Erde zehnmal schneller als durch die Luft. Diese Mitteilung ist überhaupt auch hierin merkwürdig, daß, wenn die Physiker von einem Schallstoff sprachen, der sich durch die Poren der Körper schnell hindurch bewegte, dies sich hier vollends in seiner ganzen Unhaltbarkeit zeigt.
§ 301
An dem Erzittern ist das Schwingen, als äußere Ortsveränderung, nämlich des räumlichen Verhältnisses zu anderen Körpern, zu unterscheiden, welches gewöhnliche eigentliche Bewegung ist. Aber obzwar unterschieden, ist es zugleich identisch mit der vorhin bestimmten inneren Bewegung, welche die freiwerdende Subjektivität, die Erscheinung des Klanges als solchen ist.
Die Existenz dieser Idealität hat, um ihrer abstrakten Allgemeinheit willen, nur quantitative Unterschiede. Im Reiche des Klanges und der Töne beruht daher ihr weiterer Unterschied gegeneinander, ihre Harmonie und Disharmonie auf Zahlenverhältnissen und deren einfacherem oder verwickelterem und entfernterem Zusammenstimmen.
Das Schwingen der Saiten, Luftsäulen, Stäbe usf. ist abwechselnder Übergang aus der geraden Linie in den Bogen, und zwar in entgegengesetzte [Bögen]; mit dieser so nur scheinenden äußeren Ortsveränderung im Verhältnisse zu anderen Körpern ist unmittelbar die innere, die abwechselnde Veränderung der spezifischen Schwere und der Kohäsion verbunden; die gegen den Mittelpunkt des Schwingungsbogens zu liegende Seite der materiellen Linie ist verkürzt, die äußere Seite aber verlängert worden, die spezifische Schwere und Kohäsion von dieser also vermindert, von jener vermehrt, und dies selbst gleichzeitig.
In Ansehung der Macht der quantitativen Bestimmung in diesem ideellen Boden ist an die Erscheinungen zu erinnern, wie eine solche Bestimmung, durch mechanische Unterbrechungen in eine schwingende Linie, Ebene gesetzt, sich selbst der Mitteilung, dem Schwingen der ganzen Linie, Ebene über den mechanischen Unterbrechungspunkt hinaus mitteilt und Schwingungsknoten darin bildet, was durch die Darstellungen Chladnis92) anschaulich gemacht wird. - Ebenso gehören hierher die Erweckungen von harmonischen Tönen in benachbarten Saiten, denen bestimmte Größenverhältnisse zu der tönenden gegeben werden; am allermeisten die Erfahrungen, auf welche Tartini zuerst aufmerksam gemacht93) , von Tönen, die aus anderen, gleichzeitig ertönenden Klängen, welche in Ansehung der Schwingungen in bestimmten Zahlenverhältnissen gegeneinanderstehen, hervorgehen, von diesen verschieden sind und nur durch diese Verhältnisse produziert werden.
Zusatz.
Die Schwingungen sind die Erzitterungen der Materie in sich selbst, die sich als klingend in dieser Negativität erhält, nicht vernichtet wird. Ein klingender Körper muß eine materielle physische Fläche oder Linie sein, dabei begrenzt, damit die Schwingungen durch die ganze Linie gehen, gehemmt seien und zurückkommen. Der Schlag auf einen Stein gibt nur einen Schall, kein klingendes Erzittern, weil die Erschütterung sich zwar fortpflanzt, aber nicht zurückkehrt.
Die durch die wiederkehrende Regelmäßigkeit der Schwingungen hervorgebrachten Modifikationen des Klangs sind nun die Töne; dies ist die wichtigere Verschiedenheit der Klänge, die sich in der Musik zeigt. Einklang ist vorhanden, wenn zwei Saiten gleich viel Schwingungen in derselben Zeit machen.
Von der verschiedenen Dicke, Länge und Spannung der Saiten oder Luftsäulen, die man erklingen läßt, je nachdem das Instrument ein Saiten- oder Blasinstrument ist, hängt dagegen die Verschiedenheit der Töne ab. Sind nämlich von den drei Bestimmungen der Dicke, Länge und Spannung je zwei einander gleich, so hängt der Ton von der Verschiedenheit der dritten Bestimmtheit ab, und hier ist bei Saiten die verschiedene Spannung am leichtesten zu beobachten, weshalb man diese am liebsten zugrunde legt, um die Verschiedenheit der Schwingungen zu berechnen. Die verschiedene Spannung bewirkt man dadurch, daß man die Saite über einen Steg leitet und ein Gewicht daran hängt. Ist nur die Länge verschieden, so macht eine Saite in derselben Zeit desto mehr Schwingungen, je kürzer sie ist. Bei Blasinstrumenten gibt die kürzere Röhre, worin man eine Luftsäule in Erschütterung bringt, einen schärferen Ton; um aber die Luftsäule zu verkürzen, braucht man nur einen Stempel hineinzustecken. Bei einem Monokord, wo man die Saite einteilen kann, steht die Menge der Schwingungen in derselben Zeit zu den Teilen dieser bestimmten Länge in umgekehrtem Verhältnis; das Drittel der Saite macht dreimal mehr Schwingungen als die ganze Saite. Kleine Schwingungen bei hohen Tönen lassen sich wegen ihrer großen Schnelligkeit nicht mehr zählen; die Zahlen lassen sich aber nach Analogie ganz genau bestimmen durch die Einteilung der Saite.
Indem die Töne eine Weise unserer Empfindung sind, so sind sie uns entweder angenehm oder unangenehm; diese objektive Weise des Wohlklangs ist eine Bestimmtheit, die in dieses Feld des Mechanischen eintritt.
Das Interessanteste ist das Zusammenfallen dessen, woran das Ohr eine Harmonie findet nach den Zahlenverhältnissen. Es ist Pythagoras, der diese Zusammenstimmung zuerst gefunden hat und dadurch veranlaßt wurde, auch Gedankenverhältnisse in der Weise von Zahlen auszudrücken.
Das Harmonische beruht auf der Leichtigkeit der Konsonanzen und ist eine in dem Unterschiede empfundene Einheit, wie die Symmetrie in der Architektur. Die bezaubernde Harmonie und Melodie, dies die Empfindung und Leidenschaft Ansprechende, soll von abstrakten Zahlen abhängen? Das scheint merkwürdig, ja wunderlich; aber es ist nur diese Bestimmung da, und wir können darin eine Verklärung der Zahlenverhältnisse sehen. Die leichteren Zahlenverhältnisse, welche der ideelle Grund des Harmonischen in den Tönen sind, sind nun die, welche leichter aufzufassen sind; und das sind vorzugsweise die durch die Zahl Zwei. Die Hälfte der Saite schwingt die Ober-Oktave zum Ton der ganzen Saite, der der Grundton ist. Wenn die Längen beider Saiten sich verhalten wie 2 : 3 oder wenn die kürzere zwei Drittel der Länge der andern hat und sie also drei Schwingungen in einerlei Zeit gegen zwei Schwingungen derselben macht, so gibt diese kürzere die Quinte der längeren an.
Wenn 3/4 einer Saite schwingt, so gibt dies die Quarte, welche vier Schwingungen macht, während der Grundton drei macht; 4/5 gibt die große Terz mit fünf Schwingungen gegen vier; 5/6 die kleine Terz mit sechs Schwingungen gegen fünf usf. Läßt man 1/3 des Ganzen schwingen, so hat man die Quinte der höheren Oktave. Läßt man 1/4 schwingen, so hat man die noch höhere Oktave. Ein Fünftel der Saite gibt eine Terz der dritten höheren Oktave oder die doppelte Oktave der großen Terz; 2/5 ist die Terz der nächsten Oktave, 3/5 die Sexte. Ein Sechstel ist die höhere Quinte der dritten Oktave usw. Der Grundton macht also eine Schwingung, während seine Oktave zwei Schwingungen macht; die Terze macht 11/4 Schwingung, die Quinte eine Schwingung und eine halbe und ist die Dominante. Die Quarte hat schon ein schwierigeres Verhältnis: die Saite macht 11/3 Schwingung, was schon verwickelter ist als 11/2 und 11/4; darum ist die Quarte 9/178 auch ein frischerer Ton. Das Verhältnis der Anzahl der Schwingungen in einer Oktave ist sonach folgendes: Wenn c eine Schwingung macht, so macht d 9/8, e 5/4, f 4/3, g 3/2, a 5/3, h 15/8, c 2; oder das Verhältnis ist: 24/24, 27/24, 30/24, 32/24, 36/24, 40/24, 45/24, 48/24. Teilt man eine Saite im Gedanken in fünf Teile und läßt das eine Fünftel, welches man allein wirklich abteilt, schwingen, so bilden sich Knoten in dem Rest der Saite, indem diese sich dann von selbst in die übrigen Teile teilt; denn tut man Papierchen auf die Punkte der Einteilung, so bleiben sie sitzen, während sie woanders hingesteckt herunterfallen, so daß an jenen Punkten die Saite ruht; und das sind eben die Schwingungsknoten, die weitere Konsequenzen nach sich ziehen. Eine Luftsäule macht auch solche Knoten, z. B. bei einer Flöte, wenn die Schwingungen durch Löcher Unterbrechungen erhalten. Das Ohr nimmt und findet nun angenehme Empfindungen in den Einteilungen durch die einfachen Zahlen 2, 3, 4, 5; sie können bestimmte Verhältnisse ausdrücken, die den Begriffsbestimmungen analog sind, statt daß die anderen Zahlen, als vielfache Zusammensetzungen in sich selbst, unbestimmt werden. Zwei ist die Produktion des Eins aus sich selbst, Drei ist die Einheit des Eins und Zwei; daher brauchte sie Pythagoras als Symbole der Begriffsbestimmungen. Ist die Saite durch 2 geteilt, so ist keine Differenz und Harmonie, weil es zu eintönig ist. Durch 2 und 3 geteilt, gibt die Saite aber Harmonie, als Quinte; ebenso bei der Terz, die durch 4 und 5, und bei der Quarte, die durch 3 und 4 geteilt ist.
Der harmonische Dreiklang ist der Grundton mit Terz und Quinte; dies gibt ein bestimmtes System von Tönen, ist aber noch nicht die Tonleiter. Die Alten hielten sich mehr an jene Form; es tritt aber nun ein weiteres Bedürfnis ein. Legen wir nämlich einen empirischen Ton c zugrunde, so ist g die Quinte. Da es aber zufällig ist, daß c zugrunde lag, so ist jeder Ton als Grundlage eines Systems darzustellen. Im System eines jeden Tons kommen also Töne vor, die auch im System der andern vorkommen; was aber in einem System die Terz ist, das ist im andern die Quarte oder Quinte. Damit führt sich das Verhältnis herbei, daß man einen und denselben Ton, der in den verschiedenen Tonsystemen verschiedene Funktionen übernimmt und so alles durchläuft, für sich heraushebt, mit einem neutralen Namen wie g usw. bezeichnet und ihm eine allgemeine Stellung gibt. Dies Bedürfnis einer abstrakten Betrachtung des Tons erscheint dann auch als ein anderes formelles Bedürfnis, daß das Ohr in einer Reihe von Tönen fortgehen will, die durch gleiche Intervalle auf- und absteigen; dies, vereinigt mit dem harmonischen Dreiklang, gibt erst die Tonleiter.
Wie historisch übergegangen worden zur Ansicht und Gewohnheit unserer Weise, die Töne in der Sukzession von c, d, e, f usf. als Grundlage zu betrachten, weiß ich nicht; die Orgel vielleicht hat das Ihrige getan. Das Verhältnis von Terz und Quinte hat hier keine Bedeutung; sondern die arithmetische Bestimmung der Gleichförmigkeit waltet hier allein, und das hat für sich keine Grenze. Die harmonische Grenze dieses Aufsteigens ist durch das Verhältnis 1 : 2 gegeben, den Grundton und seine Oktave; zwischen diesen muß man nun also auch die absolut bestimmten Töne nehmen. Die Teile der Saite, wodurch man solche Töne hervorbringen will, müssen größer als die Hälfte der Saite sein; denn wären sie kleiner, so würden die Töne höher als die Oktave sein. Um nun jene Gleichförmigkeit hervorzubringen, muß man in den harmonischen Dreiklang Töne einschieben, die ungefähr das Verhältnis zueinander haben wie die Quarte zur Quinte; so entstehen die ganzenTöne, die ein ganzes Intervall bilden, wie eben das Fortschreiten der Quarte zur Quinte ist. Der Zwischenraum von Grundton und Terz füllt sich aus durch die Sekunde, wenn 8/9 der Saite schwingen; dieses Intervall vom Grundton zur Sekunde (von c zu d) ist dasselbe als das von der Quarte zur Quinte (von f zu g) und das der Sexte zur Septime (a : h). Die Sekunde (d) hat dann auch ein Verhältnis zur Terz (e): das ist auch ungefähr ein ganzer Ton, jedoch nur nahezu dasselbe Verhältnis als das von c zu d; ganz genau passen sie nicht ein. Die Quinte verhält sich zur Sexte (g : a), wie d zu e. Das Verhältnis der Septime (durch 8/15 der Saite) zur höheren Oktave (h : c) ist aber wie das Verhältnis der Terz zur Quarte (e : f ). In diesem Fortschritt von e zu f und h zu c liegt nun noch eine größere Ungleichheit gegen die übrigen Abstände, zwischen die man, um diese Ungleichheit auszufüllen, dann noch die sogenannten halben Töne, d. i. die der Klavier-Tastatur nach oberen Töne, einschiebt - ein Fortgang, der eben unterbrochen wird bei e zu f und bei h zu c. So hat man eine gleichförmige Sukzession; ganz gleichförmig ist sie indessen immer nicht. Auch die übrigen Intervalle, die ganze Töne heißen, sind, wie bemerkt, nicht vollkommen gleich, sondern unter sich verschieden als die größeren (tons majeurs) und die kleineren Töne (tons mineurs). Zu jenen gehören die Intervalle von c zu d, von f zu g und von a zu h, die einander gleich sind; zu diesen gehören dagegen die Intervalle von d zu e und von g zu a, die zwar einander auch gleich, aber verschieden von den ersten sind, indem sie nicht ganz ein ganzer Ton sind. Dieser kleine Unterschied der Intervalle ist das, was man das Komma in der Musik nennt. Aber jene Grundbestimmungen von Quinte, Quarte, Terz, usf. müssen zugrunde liegen bleiben; die formelle Gleichförmigkeit des Fortschreitens muß zurückstehen. Gleichsam das bloß mechanisch, nach verhältnisloser Arithmetik (1, 2, 3, 4) fortschreitende Ohr, das sich 1 zu 2 festgemacht, muß dem Ohr, das an jene Verhältnisse der absoluten Einteilung hält, weichen. Die Verschiedenheit ist überdem sehr unbeträchtlich, und das Ohr weicht den inneren überwiegenden harmonischen Verhältnissen.
Die harmonische Grundlage und die Gleichförmigkeit des Fortschreitens bilden auf diese Weise den ersten Gegensatz, der sich hier ergibt. Und weil beide Prinzipien nicht genau miteinander übereinstimmen, so kann gefürchtet werden, daß bei weiterer Ausführung des Systems der Töne dieser Unterschied bestimmter zum Vorschein kommt, nämlich wenn einer der Töne, die bei einem bestimmten Grundton Töne seiner Skala ausmachen, zum Grundton gemacht (denn an sich ist es gleichgültig, welcher es ist, da jeder dasselbe Recht hat) und für dessen Skala dieselben Töne - und zwar für mehrere Oktaven - gebraucht werden sollen.
Also wenn g Grundton ist, so ist d die Quinte; bei h aber ist d die Terz, die Quarte für a usw. Indem derselbe Ton einmal Terz dann Quarte, dann Quinte sein soll, so läßt sich dies nicht vollkommen leisten bei Instrumenten, wo die Töne fix sind. Hier tritt nun jene Verschiedenheit bei weiterer Verfolgung eben weiter auseinander. Die in einer Tonart richtigen Töne werden in einer andern unpassend, was nicht der Fall wäre, wenn die Intervalle gleich wären. Die Tonarten erhalten dadurch eine innere Verschiedenheit, d. i. eine solche, die auf der Natur der Verhältnisse der Töne ihrer Skala beruht.
Es ist bekannt, daß, wenn z. B. die Quinte von c (g) nun zum Grundton gemacht wird und deren Quinte d genommen wird und von dieser wieder die Quinte usf. auf dem Klavier dann die elfte und zwölfte Quinte unrein sind und nicht mehr in das System passen, wo diese Töne nach c gestimmt wären; das sind also in bezug auf c die falschen Quinten. Und davon hängt dann auch eine Veränderung der weiteren Töne, der halben Töne usf. ab, bei denen die Unreinheiten, Differenzen und Disharmonien schon viel früher herauskommen. Dieser Verwirrung hilft man ab, so gut man kann, indem man z. B. die Ungleichheiten auf eine gleichmäßige, billige Weise verteilt. So hat man auch vollkommen harmonische Harfen erfunden, wo jedes System, c, d usw., seine eigenen halben Töne hat. Sonst brach man αa) jeder Quinte von Anfang an etwas ab, den Unterschied gleichförmig zu verteilen. Da dies aber feinen Ohren wieder schlecht tönte, so mußte man β) das Instrument auf den Umfang von sechs Oktaven beschränken (wiewohl auch hier bei Instrumenten, wo die Töne fix, neutral sind, noch Abweichungen genug vorkommen), überhaupt in solchen Tonarten weniger spielen, wo dergleichen Dissonanzen eintreten, oder solche einzelne Kombinationen vermeiden, wo die Töne auffallend unrein sind.
Nur dies muß noch namhaft gemacht werden, wie das Harmonische auf objektive Weise erscheint, - seine sachliche Wirksamkeit. Es kommen dabei Erscheinungen vor, die auf den ersten Anblick paradox sind, da in dem bloß Hörbaren der Töne gar kein Grund davon angegeben werden kann, und die allein aus den Zahlenverhältnissen zu fassen sind. Läßt man erstens eine Saite schwingen, so teilt sie sich selbst in ihrem Schwingen in diese Verhältnisse ein; dies ist ein immanentes, eigentümliches Naturverhältnis, eine Tätigkeit der Form in sich selbst. Man hört nicht nur den Grundton (1), auch die Quinte der höhere (3) und die Terz der noch höheren Oktave (5); ein geübtes Ohr bemerkt auch noch die Oktave des Grundtons (2) und dessen doppelte Oktave (4). Es werden also die Töne gehört, die vorgestellt sind durch die ganzen Zahlen: 1, 2, 3, 4, 5. Indem nämlich bei solchen Saiten zwei feste Punkte sind, so bildet sich ein Schwingungsknoten in der Mitte; dieser tritt nun wieder in Verhältnis zu den Endpunkten, und dies gibt so die Erscheinung des Verschiedenen, das harmonisch ist.
Das zweite ist dieses, daß Töne hervorkommen können, die nicht unmittelbar angeschlagen, sondern durch das Anschlagen anderer erweckt werden. Daß eine angeschlagene Saite diesen Ton gibt, weil sie ihn hat, nennt man begreiflich. Schwieriger zu fassen ist es nun, warum, wenn man mehrere Töne anschlägt, oft doch nur ein Ton hörbar wird oder, wenn man zwei Töne anschlägt, ein dritter sich hörbar macht. Auch dies beruht auf der Natur der Beziehung dieser Zahlenbestimmungen aufeinander. αa) Die eine Erscheinung ist die, daß, wenn man Töne nimmt, die in einem gewissen Verhältnis stehen, und alle ihre Saiten zusammen anschlägt, man nur den Grundton hört. Man hat z. B. ein Register in der Orgel, wo eine Taste angeschlagen fünf Pfeifentöne hervorbringt. Jede Pfeife hat nun zwar einen besonderen Ton, doch ist das Resultat dieser fünf Töne nur einer. Dieses findet statt, wenn diese fünf Pfeifen oder Töne folgende sind: 1. der Grundton c; 2. die Oktave von c; 3. die Quinte (g) der nächsten Oktave; 4. das dritte c; 5. die Terz (e) der noch höheren Oktave. Man hört dann nur den Grundton c, was darauf beruht, daß die Schwingungen zusammenfallen. Jene verschiedenen Töne müssen allerdings in einer gewissen Höhe genommen werden, nicht zu tief und nicht zu hoch. Der Grund dieses Zusammenfallens ist nun aber dieser: Wenn das untere c eine Schwingung macht, so macht die Oktave zwei Schwingungen. Das g dieser Oktave macht drei Schwingungen, während der Grundton eine macht; denn die nächste Quinte macht 1 1/2 Schwingungen, dieses g also drei. Das dritte c macht vier Schwingungen. Die Terz desselben macht fünf Schwingungen, während der Grundton eine macht. Denn die Terz macht zum Grundton 5/4 Schwingungen, die Terz der dritten Oktave aber viermal soviel; und das sind fünf Schwingungen. Die Schwingungen sind also hier so beschaffen, daß die Schwingungen der anderen Töne mit den Schwingungen des Grundtons koinzidieren. Die Saiten dieser Töne haben das Verhältnis von 1, 2, 3, 4, 5, und alle ihre Schwingungen sind zugleich vorbei, indem nach fünf Schwingungen des höchsten Tons die tieferen gerade vier, drei, zwei oder eine Schwingung vollbracht haben. Wegen dieser Koinzidenz hört man nur das eine c.
β) Ebenso ist es dann auch mit dem andern Fall, wo, wenn man, nach Tartini, zwei verschiedene Saiten einer Gitarre anschlägt, das Wunderbare geschieht, daß man außer ihren Tönen auch noch einen dritten Ton hört, der aber nicht bloß die Vermischung der beiden ersten, kein bloß abstrakt Neutrales ist. Schlägt man z. B. c und g in gewisser Höhe zusammen an, so hört man c, das eine Oktave tiefer ist, mittönen.
Der Grund dieser Erscheinung ist der: Macht der Grundton eine Schwingung, so macht die Quinte 11/2 oder drei, während der Grundton zwei macht. Schwingt der Grundton einmal, so hat, während diese erste Schwingung noch dauert, schon die zweite Schwingung der Quinte angefangen.
Aber die zweite Schwingung von c, die während der Dauer der zweiten Schwingung von g anfängt, endet zu gleicher Zeit mit der dritten Schwingung von g, so daß auch der neue Anfang des Schwingens zusammenfällt. "Es gibt Epochen", sagt daher Biot (Traité de Physique II, p. 47)94) , "wo die Schwingungen zugleich, und andere, wo sie getrennt ins Ohr kommen", - wie wenn einer drei Schritte in derselben Zeit macht, in welcher der andere zwei macht, wo dann, nach drei Schritten des ersten und zwei Schritten des zweiten,
sie beide zugleich mit dem Fuße auftreten. Es entsteht auf diese Weise eine abwechselnde Koinzidenz nach zwei Schwingungen von c. Dieses Zusammenfallen ist doppelt so langsam oder halb so schnell als das Schwingen von c. Wenn aber eine Tonbestimmung halb so schnell ist als die andere, so entsteht die untere Oktave, die einmal schwingt, während die obere zweimal. Die Orgel gibt diese Erfahrung am besten, wenn sie ganz rein gestimmt ist. Man hört also die tiefere Oktave, z. B. auch auf einem Monokord, obgleich man sie dort nicht selbst hervorbringen kann. Abt Vogler95) hat hierauf ein eigentümliches System des Orgelbaus gegründet, so daß mehrere Pfeifen, deren jede für sich einen eigenen Ton hat, zusammen einen anderen reinen Ton angeben, der dann für sich keiner besonderen Pfeife und keiner besonderen Taste bedarf.
Wenn man sich in Ansehung der Harmonie mit dem Gehör begnügen und sich nicht auf Verhältnisse von Zahlen einlassen wollte, so läßt sich ganz und gar nicht Rechenschaft davon geben, daß Töne, die zugleich gehört werden, obgleich für sich voneinander verschieden, doch als ein Ton gehört werden. Man darf also in Ansehung der Harmonie nicht beim bloßen Hören stehenbleiben, sondern muß die objektive Bestimmtheit erkennen und wissen. Das Weitere ginge indessen das Physikalische und dann die musikalische Theorie an. Dies aber, was gesagt, gehört hierher, insofern der Ton diese Idealität im Mechanischen ist, die Bestimmtheit desselben also gefaßt werden muß als eine mechanische und, was eben im Mechanischen die Bestimmtheit ist, erkannt werden muß.
§ 302
Der Klang ist der Wechsel des spezifischen Außereinanderseins der materiellen Teile und des Negiertseins desselben; nur abstrakte oder sozusagen nur ideelle Idealität dieses Spezifischen. Aber dieser Wechsel ist hiermit selbst unmittelbar die Negation des materiellen spezifischen Bestehens; diese ist damit reale Idealität der spezifischen Schwere und Kohäsion, - Wärme.
Die Erhitzung der klingenden Körper wie der geschlagenen, auch der aneinandergeriebenen, ist die Erscheinung von der dem Begriffe nach mit dem Klange entstehenden Wärme.
Zusatz. Das sich im Klange kundgebende Insichsein ist selbst materialisiert, beherrscht die Materie und erhält so sinnliches Dasein, indem der Materie Gewalt angetan wird. Weil das Insichsein als Tönen nur bedingte Individualität, noch nicht reale Totalität ist, so ist das Erhalten seiner selbst nur die eine Seite; die andere aber ist, daß diese vom Insichsein durchdrungene Materialität auch zerstörbar ist. Mit dieser inneren Erschütterung des Körpers in sich selbst ist also nicht nur Aufheben der Materie auf ideelle Weise vorhanden, sondern auch reales Aufheben durch die Wärme. Das sich auf spezifische Weise als Selbsterhaltendes Zeigen des Körpers geht vielmehr in die Negativität seiner selbst über. Die Wechselwirkung seiner Kohäsion in sich selbst ist zugleich Anderssetzen seiner Kohäsion, beginnendes Aufheben seiner Rigidität, und das ist eben die Wärme. Klang und Wärme sind so unmittelbar verwandt; Wärme ist die Vollendung des Klangs, die am Materiellen sich hervortuende Negativität dieses Materiellen; wie denn schon der Klang bis zum Springen oder Schmelzen fortgehen, ja ein Glas entzweigeschrien werden kann. Der Vorstellung liegt Klang und Wärme zwar auseinander, und es kann frappant scheinen, beides so einander zu nähern. Wenn aber z. B. eine Glocke geschlagen wird, wird sie heiß; und diese Hitze ist ihr nicht äußerlich, sondern durch das innere Erzittern ihrer selbst gesetzt. Nicht nur der Musikus wird warm, sondern auch die Instrumente.
90) Ernst Florens Friedrich Chladni, Entdeckungen über die Theorie des Klangs, Leipzig 1787;
Die Akustik, Leipzig 1802
91) Johann Wilhelm Ritter, 1776-1810, Naturwissenschaftler; entdeckte 1801 die ultravioletten Strahlen.
92) Ernst Florens Friedrich Chladni, Entdeckungen über die Theorie des Klangs, Leipzig 1787;
Die Akustik, Leipzig 1802
93) Guiseppe Tartini, Trattato di musica secondo la vera scienza dell' Armonia, Padova 1754
94) Jean Baptiste Biot, Traité de physique experimentale et mathématique, 4 Bde., Paris 1816. "Alle permanenten Gase dehnen sich bei gleicher Temperatur und gleichem Druck um gleichviel aus."
95) Georg Joseph Vogler, 1749-1814, Musiker
|
|