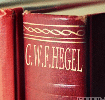|
b. Der Kultus als Dienst
Kommt es nun darauf an, daß die Subjektivität sich mit Bewußtsein die Identität mit dem gegenüberstehenden Göttlichen gebe, so müssen beide Teile von ihrer Bestimmtheit aufgeben: Gott steigt herab von seinem Weltenthron, gibt sich selber preis, und der Mensch muß beim Empfang der Gabe die Negation des subjektiven Selbstbewußtseins leisten, d. h. den Gott anerkennen oder die Gabe mit der Anerkennung der Wesentlichkeit, die darin ist, in Empfang nehmen. Der Gottesdienst ist demnach die Wechselseitigkeit des Gebens und Empfangens. Jede Seite läßt von der Besonderheit, die sie voneinander scheidet, ab.
α) Das äußerlichste Verhältnis beider Seiten gegeneinander ist, daß der Gott ein Naturelement in sich hat und selbständig gegen das Selbstbewußtsein unmittelbar da ist oder sein Dasein in einer äußeren, natürlichen Erscheinung hat. In diesem Verhältnis ist der Gottesdienst einerseits die Anerkennung, daß die natürlichen Dinge ein Wesen in sich sind; andererseits opfert sich die Gottheit in der Naturmacht, in der sie erscheint, selbst auf und läßt sich vom Selbstbewußtsein in Besitz nehmen. Wenn sich nun die göttlichen Mächte als Naturgaben preisgeben und freundlich zum Gebrauche darbieten, so hat der Dienst, in dem sich der Mensch das Bewußtsein der Einheit mit seinen Mächten gibt, folgenden Sinn.
Diese Früchte, diese Quelle, sie lassen sich ungehindert schöpfen oder sich greifen und verzehren; sie fallen willig in den Schoß. Der Mensch ißt die Gaben, trinkt den Wein, gewinnt Stärkung und Begeisterung seines Sinnes, und diese Stärkung, worin sie Moment sind, ist ihre Wirkung. In diesem Verhältnisse ist nicht Stoß und Gegenstoß, das traurige, sich fortpflanzende Einerlei des Mechanischen, sondern zu Ehren gebracht werden jene Gaben, indem sie der Mensch ißt und trinkt; denn welche höhere Ehre kann den Naturdingen werden, als daß sie als die Kräftigkeit des geistigen Tuns erscheinen? Der Wein begeistert; aber erst der Mensch ist es, der ihn zum Begeisternden und Kräftigenden erhebt. Es verschwindet insofern das Verhältnis der Not; die Notdurft dankt den Göttern für das Empfangen, und sie setzt eine Trennung voraus, welche aufzuheben nicht in der Gewalt des Menschen steht. Die eigentliche Not tritt erst ein durch Eigentum und Festhalten eines Willens. Zu den Naturgaben steht aber der Mensch nicht in solchem Verhältnisse der Not; sie haben es ihm im Gegenteil zu danken, daß etwas aus ihnen wird; ohne ihn würden sie verfaulen, vertrocknen und unnütz vergehen.
Das Opfer, das sich mit dem Genuß dieser Naturgaben verbindet, hat hier nicht den Sinn der Opferung des Innern oder der konkreten Erfüllung des Geistes, sondern diese ist es vielmehr, die bestätigt und selbst genossen wird. Das Opfer kann nur den Sinn haben der Anerkennung der allgemeinen Macht, welche das theoretische Aufgeben eines Teiles des zu Genießenden ausdrückt; d. h. diese Anerkennung ist die nutzlose, zwecklose, nämlich nicht praktische, nicht selbstsüchtige Hingabe, z. B. die Ausgießung einer Schale Weines. Aber zugleich ist das Opfer selbst der Genuß: der Wein wird getrunken, das Fleisch wird gegessen, und es ist die Naturmacht selbst, deren einzelnes Dasein und Äußerung aufgeopfert und vernichtet wird. Essen heißt Opfern, und Opfern heißt selbst Essen.
So knüpft sich an alles Tun des Lebens dieser höhere Sinn und der Genuß darin: jedes Geschäft, jeder Genuß des täglichen Lebens ist ein Opfer. Der Kultus ist nicht Entsagung, nicht Aufopferung eines Besitzes, einer Eigentümlichkeit, sondern der idealisierte, theoretisch-künstlerische Genuß. Freiheit und Geistigkeit ist über das ganze tägliche und unmittelbare Leben ausgebreitet, und der Kultus ist überhaupt eine fortgehende Poesie des Lebens.
Der Kultus dieser Götter ist daher nicht Dienst im eigentlichen Sinne zu nennen als gegen einen fremden, selbständigen Willen, von dessen zufälligem Entschließen Begehrtes zu erlangen wäre; sondern die Verehrung enthält selbst schon eine vorhergehende Gewährung, oder sie ist selbst der Genuß.
Es ist nicht darum zu tun, aus ihrem Jenseits eine Macht zu sich zurückzurufen und zu diesem Ende, um ihrer empfänglich zu sein, sich selbst dasjenige abzutun, was von der subjektiven Seite des Selbstbewußtseins aus die Scheidung macht; es ist also nicht zu tun um Entbehrung, Entsagung, Abtun einer subjektiven Eigentümlichkeit, nicht um Angst, Selbstpeinigung, Selbstqual. Der Kultus des Bacchus, der Ceres ist der Besitz, Genuß des Brotes, Weines, das Verzehren desselben also die unmittelbare Gewährung selbst. Die Muse, die Homer anruft, ist zugleich sein Genie usf.
Die allgemeinen Mächte treten dann aber auch freilich weiter zurück in die Ferne gegen das Individuum. Die Quelle läßt sich ungehindert schöpfen, das Meer sich befahren, aber es erbraust auch zum Sturme, und es und die Gestirne sind dem Menschen nicht nur nicht willfährig, sondern furchtbar und Untergang bringend. Die Muse ist auch dem Dichter nicht immer günstig, tritt zurück und bedient ihn schlecht (eigentlich aber ruft sie der Dichter überhaupt nur an, wenn er das Gedicht macht, und die Anrufung und der Preis ist selbst Poesie); die Athene selbst, der Geist, Gott wird sich ungetreu. - Die Tyrer banden ihren Herkules mit Ketten an, daß er ihre Stadt, seine Realität und sein wirkliches Dasein nicht verlassen solle, und doch ist Tyros gefallen. Aber solche Entfremdung ihrer Wesenheit führte nicht zur absoluten Entzweiung und nicht zur Zerrissenheit des Innern, welche die Menschen nötigen würde, sie gleichsam mit Gewalt des Geistes im Kultus zu sich zu ziehen, womit der Verfall in Zauberei verbunden wäre. Zu diesen besonderen Mächten kann das Individuum nicht in unendlichen Gegensatz treten, weil sie als besondere Zwecke sich in die Notwendigkeit versenken und in dieser selbst aufgegeben werden.
Der Dienst besteht daher darin, daß die allgemeinen Mächte für sich herausgehoben und anerkannt werden. Der Gedanke erfaßt das Wesentliche, Substantielle seines konkreten Lebens und bleibt somit weder dumpf in die empirische Einzelheit des Lebens versenkt und zerstreut, noch geht er von ihr nur zu dem abstrakten Einen, zu dem unendlichen Jenseits; sondern indem der Geist das Wahre, die Idee seines mannigfaltigen Daseins sich darstellt, so ist er in der Anerkennung und Ehrung dieses Allgemeinen selbst im Genusse und bleibt seiner selbst gegenwärtig. Diese Gegenwart des Geistes in seinen Wesenheiten ist einerseits das würdige, denkende, theoretische Verhältnis, andererseits diese Freudigkeit, Heiterkeit und Freiheit, die ihrer selbst darin gewiß und bei sich selbst ist.
β) Auch der Dienst als Verhalten zu den Göttern nach ihrer geistigen Seite hat nicht den Sinn, sich diese Mächte erst anzueignen, sich der Identität mit ihnen erst bewußt zu werden. Denn diese Identität ist bereits vorhanden, und der Mensch findet diese Mächte in seinem Bewußtsein bereits realisiert. Die bestimmte Geistigkeit, Recht, Sitte, Gesetz oder die allgemeinen Wesenheiten, wie die Liebe, Aphrodite, kommen in den Individuen, den sittlichen Individuen, den Wissenden, Liebenden zu ihrer Wirklichkeit; sie sind der eigene Wille, die eigene Neigung und Leidenschaft derselben, ihr eigenes, wollendes, handelndes Leben. Es bleibt somit für den Kultus nur übrig, diese Mächte anzuerkennen, sie zu ehren und somit die Identität in die Form des Bewußtseins zu erheben und zur theoretischen Gegenständlichkeit zu machen.
Vergleichen wir diese Gegenständlichkeit mit unserer Vorstellung, so heben wir auch das Allgemeine aus unserem unmittelbaren Bewußtsein heraus und denken dasselbe. Wir können auch dazu fortgehen, diese allgemeinen Mächte zum Idealen zu erheben und ihnen geistige Gestalt zu geben. Aber solchen Gebilden Gebet zu weihen, Opfer zu bringen, das ist der Punkt, wo wir uns von jener Anschauung trennen, bis dahin können wir nicht gehen, jenen Bildern, welche jedoch keine Einbildungen, sondern wesentliche Mächte sind, vereinzelte Selbständigkeit zu geben und ihnen Persönlichkeit gegen uns zuzuschreiben. Unser Bewußtsein der unendlichen Subjektivität als einer allgemeinen zehrt jene Besonderheiten auf und setzt sie zu schönen Phantasiebildern herab, deren Gehalt und Bedeutung wir wohl zu würdigen wissen, die uns aber nicht als wahrhaft selbständig gelten können.
Im griechischen Leben aber ist die Poesie, die denkende Phantasie selbst der wesentliche Gottesdienst. Indem nun einerseits diese Mächte sich ins Unendliche zersplittern und, obwohl sie einen sich schließenden Kreis bilden, weil sie besondere sind, sich der Unendlichkeit der Anziehungen ihrer Wirklichkeit nähern (wieviel besondere Beziehungen sind z. B. in der Pallas aufgefaßt!) und weil andererseits es die menschliche, sinnlich-geistige Gestalt ist, in der das Ideal dargestellt werden soll, so ist diese Darstellung unerschöpflich und muß sich immer fortsetzen und erneuern, denn die Religiosität ist selbst dieses fortdauernde Übergehen vom empirischen Dasein zum idealen. Es ist nicht ein fester, geistig bestimmter Lehrbegriff, nicht Lehre vorhanden, die Wahrheit als solche nicht in Form des Gedankens, sondern das Göttliche in diesem immanenten Zusammenhange mit der Wirklichkeit und daher an und aus ihr immer von neuem sich erhebend und hervorbringend. Ist diese tätige Produktion durch die Kunst vollendet, hat die Phantasie ihre letzte, feste Gestalt erreicht, so daß das Ideal aufgestellt ist, so ist damit der Untergang der religiösen Lebendigkeit verbunden.
Solange aber noch die produktive Kraft dieses Standpunktes frisch und tätig ist, besteht die höchste Assimilation des Göttlichen darin, daß das Subjekt den Gott durch sich gegenwärtig macht und ihn an sich selbst zur Erscheinung bringt. Indem dabei die bewußte Subjektivität des Gottes zugleich auf einer Seite als Jenseits bleibt, so ist diese Darstellung des Göttlichen zugleich seine Anerkennung und die Verehrung seiner substantiellen Wesenheit. So wird denn das Göttliche geehrt und anerkannt, indem es in Festen, Spielen, Schauspielen, Gesängen, überhaupt in der Kunst vorstellig gemacht wird. Denn geehrt wird jemand, insofern man eine hohe Vorstellung von ihm hat und diese Vorstellung auch durch die Tat vorstellig macht und durch sein Betragen erscheinen läßt.
Indem nun das Volk in den Produktionen der Kunst, in der Ehre der Gesänge und Feste die Vorstellung des Göttlichen an ihm selber erscheinen läßt, hat es den Kultus an ihm selbst, d. h. es zeigt in seinen Festen zugleich wesentlich seine Vortrefflichkeit, es zeigt von sich das Beste, was es hat, das, wozu es fähig gewesen ist, sich zu machen. Der Mensch schmückt sich selbst; Gepränge, Kleidung, Schmuck, Tanz, Gesang, Kampf, alles gehört dazu, den Göttern Ehre zu bezeigen. Der Mensch zeigt seine geistige und körperliche Geschicklichkeit, seine Reichtümer, er stellt sich selbst in der Ehre Gottes dar und genießt damit diese Erscheinung Gottes an dem Individuum selbst. Dies gehört noch jetzt zu den Festen. Diese allgemeine Bestimmung kann genügen, daß der Mensch die Vorstellung der Götter an ihm durch sich erscheinen lasse, daß er sich aufs vortrefflichste darstelle und so seine Anerkennung der Götter zeige.
Den Siegern in den Kämpfen wurde hohe Ehre zuteil; sie waren die Geehrtesten des Volks, saßen bei feierlichen Gelegenheiten neben dem Archonten, und es ist selbst geschehen, daß sie bei Lebzeiten als Götter verehrt wurden, indem sie so das Göttliche an sich zur Erscheinung brachten durch die Geschicklichkeit, die sie bewiesen hatten. Auf diese Weise machen die Individuen das Göttliche an sich erscheinen; im Praktischen ehren die Individuen die Götter, sind sittlich (das was der Wille der Götter ist, ist das Sittliche), und so bringen sie das Göttliche zur Wirklichkeit. Das athenische Volk z. B., das am Feste der Pallas seinen Aufzug hielt, war die Gegenwart der Athene, der Geist des Volks, und dies Volk ist der belebte Geist, der alle Geschicklichkeit, Tat der Athene an sich darstellt.
γ) Sosehr sich nun aber auch der Mensch der unmittelbaren Identität mit den wesentlichen Mächten gewiß wird, sich die Göttlichkeit aneignet und ihrer Gegenwart in sich und seiner selbst in ihr sich erfreut - mag er immer jene natürlichen Götter verzehren, die sittlichen in der Sitte und im Staatsleben darstellig machen, oder mag er praktisch göttlich leben und die Gestalt und Erscheinung der Göttlichkeit in dem Festdienste in seiner Subjektivität hervorbringen-, so bleibt für das Bewußtsein doch noch ein Jenseitiges zurück, nämlich das ganz Besondere am Tun und an den Zuständen und Verhältnissen des Individuums und die Beziehung dieser Verhältnisse auf Gott. Unser Glaube an die Vorsehung, daß sie sich auch auf das Einzelne erstrecke, sieht darin seine Bestätigung, daß Gott Mensch geworden ist, und zwar in der wirklichen, zeitlichen Weise, in welche somit alle partikulare Einzelheit mit eingeschlossen ist, denn dadurch hat die Subjektivität die absolut moralische Berechtigung erhalten, wodurch sie Subjektivität des unendlichen Selbstbewußtseins ist. In der schönen Gestaltung der Götter, in den Bildern, Geschichten und Lokalvorstellungen derselben ist zwar das Moment der unendlichen Einzelheit, der äußerlichsten Besonderheit unmittelbar enthalten und ausgedrückt, aber einer Besonderheit, welche einesteils einer der großen Vorwürfe gegen die Mythologie Homers und Hesiods ist, andernteils sind dies zugleich diesen vorgestellten Göttern so eigentümliche Geschichten, daß sie die anderen und die Menschen nichts angehen; wie unter den Menschen jedes Individuum seine besonderen Begebenheiten, Handlungen, Zustände und Geschichten hat, die durchaus nur seiner Partikularität angehören. Das Moment der Subjektivität ist nicht als unendliche Subjektivität; es ist nicht der Geist als solcher, der in den objektiven Gestaltungen angeschaut wird, und die Weisheit ist es, welche die Grundbestimmung des Göttlichen ausmachen müßte.
Diese müßte als zweckmäßig wirkend in eine unendliche Weisheit, in eine Subjektivität zusammengefaßt sein.
Daß die menschlichen Dinge von den Göttern regiert werden, ist daher in jener Religion wohl enthalten, aber in einem unbestimmten, allgemeinen Sinne; denn eben die Götter sind die in allem Menschlichen waltenden Mächte. Ferner sind die Götter wohl gerecht, aber die Gerechtigkeit als eine Macht ist eine titanische Macht und gehört dem Alten an; die schönen Götter machen sich in ihrer Besonderheit geltend und geraten in Kollisionen, die nur in der gleichen Ehre gelöst werden, womit aber freilich keine immanente Auflösung gegeben ist.
Von diesen Göttern, in denen nicht die absolute Rückkehr in sich gesetzt ist, konnte das Individuum nicht absolute Weisheit und Zweckmäßigkeit in seinen Schicksalen erwarten. Bei dem Menschen bleibt aber das Bedürfnis zurück, über sein besonderes Handeln und einzelnes Schicksal eine objektive Bestimmung zu haben. In dem Gedanken der göttlichen Weisheit und Vorsehung hat er dieselbe nicht, um darauf im allgemeinen vertrauen zu können und im übrigen sich auf sein formelles Wissen und Wollen zu verlassen und die absolute Vollendung desselben an und für sich zu erwarten oder einen Ersatz für den Verlust und das Mißlingen seiner besonderen Interessen und Zwecke, für sein Unglück in einem ewigen Zwecke zu suchen.
Wenn es sich um die besonderen Interessen des Menschen, um sein Glück oder Unglück handelt, so hängt dies Äußerliche der Erscheinung noch davon ab, ob der Mensch dies oder jenes tue, da oder dorthin gehe usf. Dies ist sein Tun, seine Entschließung, die er aber auch wieder als zufällig weiß. Nach den Umständen, die ich kenne, kann ich mich zwar entschließen; aber außer diesen mir bekannten können auch andere vorhanden sein, durch welche die Realisierung meines Zweckes zunichte gemacht wird. Bei diesen Handlungen bin ich also in der Welt der Zufälligkeit. Innerhalb dieses Kreises ist also das Wissen zufällig, es bezieht sich nicht auf das Ethische, wahrhaft Substantielle, Pflichten des Vaterlandes, des Staats usw.; aber dies Zufällige kann der Mensch nicht wissen. Die Entschließung kann somit insofern nichts Festes, nichts in sich Begründetes sein; sondern indem ich mich entschließe, weiß ich zugleich, daß ich von Anderem, Unbekanntem abhängig bin. Da nun weder im Göttlichen noch im Individuum das Moment der unendlichen Subjektivität vorhanden ist, so fällt es auch nicht dem Individuum anheim, die letzte Entschließung, das letzte Wollen - z. B. heute eine Schlacht zu liefern, zu heiraten, zu reisen - aus sich selbst zu nehmen; denn der Mensch hat das Bewußtsein, daß in diesem seinem Wollen nicht die Objektivität liegt und daß dasselbe nur formell ist. Um das Verlangen nach dieser Ergänzung zu befriedigen und diese Objektivität hinzuzusetzen, dazu bedurfte es einer Bestimmung von außen und von einem Höheren, als das Individuum ist, nämlich eines äußerlichen, entscheidenden und bestimmenden Zeichens. Es ist die innere Willkür, die, um nicht Willkür zu sein, sich objektiv, d. h. unveräußerlich zu einem Anderen seiner selbst macht und die äußerliche Willkür höher nimmt als sich selbst. Im ganzen ist es die Naturmacht, eine Naturerscheinung, was nun entscheidet. Der staunende Mensch findet in solcher Naturerscheinung eine Bezüglichkeit auf sich, weil er an ihr noch keine objektive, an sich seiende Bedeutung sieht oder überhaupt in der Natur noch nicht ein an sich vollendetes System von Gesetzen sieht. Das formell Vernünftige, das Gefühl und der Glaube der Identität des Inneren und Äußeren liegt zugrunde, aber das Innere der Natur oder das Allgemeine, zu dem sie in Beziehung steht, ist nicht der Zusammenhang ihrer Gesetze, sondern ein menschlicher Zweck, ein menschliches Interesse.
Indem nun also der Mensch etwas will, so fordert er, um seinen Entschluß wirklich zu fassen, eine äußere, objektive Bestätigung, daß er seinen Entschluß als einen solchen wisse, der eine Einheit des Subjektiven und Objektiven, ein bestätigter und bewahrheiteter sei. Und hier ist es das Unerwartete, Plötzliche, eine sinnlich bedeutende, unzusammenhängende Veränderung, ein Blitz am heitern Himmel, ein Vogel, der an einem weiten, gleichen Horizonte aufsteigt, was die Unbestimmtheit der inneren Unentschlossenheit unterbricht. Das ist ein Aufruf für das Innere, plötzlich zu handeln und zufällig sich in sich festzusetzen ohne Bewußtsein des Zusammenhanges und der Gründe; denn eben hier ist der Punkt, wo die Gründe abgebrochen werden oder wo sie überhaupt mangeln.
Die äußere Erscheinung, die dem Zwecke, die Bestimmung für das Handeln zu finden, am nächsten liegt, ist ein Tönen, Klingen, eine Stimme, ομή, woher Delphi wohl richtiger den Namen ομαaλος hat als nach der anderen Bedeutung: Nabel der Erde. In Dodona waren drei Arten: der Ton, den die Bewegung der Blätter der heiligen Eiche hervorbrachte, das Murmeln einer Quelle und der Ton eines ehernen Gefäßes, an welches der Wind eherne Ruten schlug. In Delos rauschte der Lorbeer; in Delphi war der Wind, der am ehernen Dreifuß ausströmte, ein Hauptmoment. Später erst mußte die Pythia durch Dämpfe betäubt werden, die dann in der Raserei Worte ohne Zusammenhang ausstieß, die erst der Priester auszulegen hatte. Er deutete auch die Träume. In der Höhle des Trophonios waren es Gesichte, die der Fragende sah und die ihm gedeutet wurden. In Achaja, erzählt Pausanias, war eine Statue des Mars; dieser sagte man die Frage ins Ohr und entfernte sich mit zugehaltenen Ohren vom Markte. Das erste Wort, welches man hörte, nachdem man die Ohren geöffnet hatte, war die Antwort, die dann durch Deutung in Zusammenhang mit der Frage gebracht wurde. Hierher gehört auch das Befragen der Eingeweide der Opfertiere, die Deutung des Vogelflugs und mehrere solche bloße Äußerlichkeiten. Man schlachtete Opfertiere, bis man die glücklichen Zeichen fand. Bei den Orakeln gaben zwei Momente die Entscheidung, das Äußerliche und die Erklärung. Nach jener Seite verhielt sich das Bewußtsein empfangend, nach der andern Seite aber ist es als deutend selbsttätig, denn das Äußerliche an sich ist unbestimmt (αaι τtων δdαaιμόνων ωναaὶ` αáναaοί εeισsιν *). Aber auch als konkreter Ausspruch des Gottes sind die Orakel doppelsinnig. Nach ihnen handelt der Mensch, indem er sich eine Seite herausnimmt. Dagegen tritt denn die andere auf; der Mensch gerät in Kollision. Die Orakel sind dies, daß der Mensch sich als unwissend, den Gott als wissend setzt; unwissend nimmt der Mensch den Spruch des wissenden Gottes auf. Er ist somit nicht Wissen des Offenbaren, sondern Nichtwissen desselben. Er handelt nicht wissend nach der Offenbarung des Gottes, welcher als allgemein die Bestimmtheit nicht in sich hat und so, in der Möglichkeit beider Seiten, doppelsinnig sein muß. Sagt das Orakel: "gehe hin, und der Feind wird überwunden", so sind beide Feinde "der Feind". Die Offenbarung des Göttlichen ist allgemein und muß allgemein sein; der Mensch deutet sie als unwissend[er]; er handelt danach; die Tat ist die seinige; so weiß er sich als schuldig. Der Vogelflug, das Rauschen der Eichen sind allgemeine Zeichen. Auf die bestimmte Frage gibt der Gott als der allgemeine eine allgemeine Antwort, denn nur das Allgemeine, nicht das Individuum als solches ist der Zweck der Götter.
Das Allgemeine aber ist unbestimmt, ist doppelsinnig, denn es enthält beide Seiten.
*) "Die Stimmen der Dämonen sind unartikuliert."
|
|